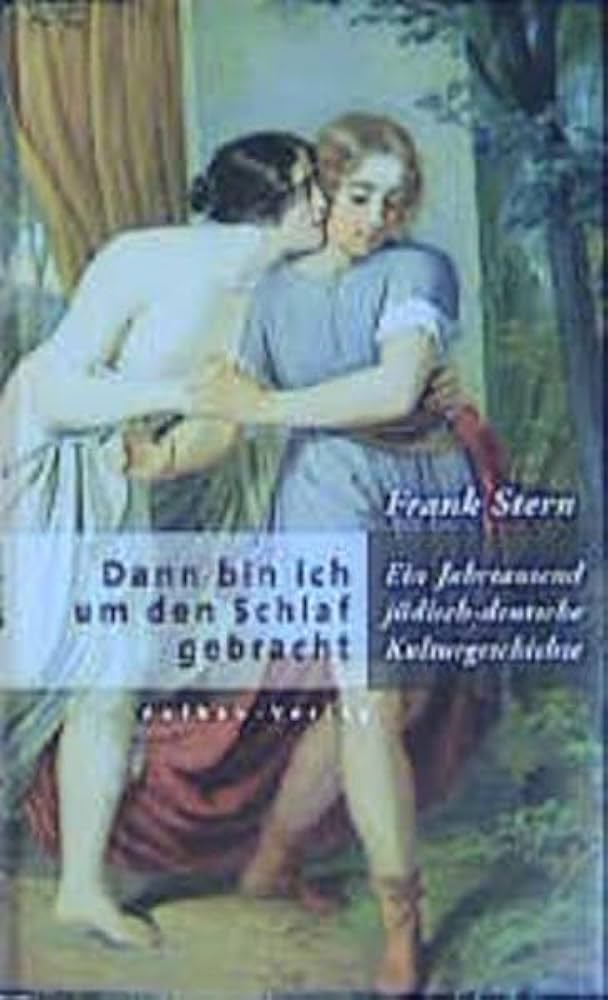In Sterns Buch findet die Rolle der Frauen in der deutsch-jüdischen Kulturgeschichte besondere Beachtung. Über Glückel von Hameln, die zwischen 1691 und 1719 ihre Erinnerungen aufschrieb, heißt es: „Sie lebte zweihundert Jahre vor Bismarck in einem um Preußen vereinigten Land, einem Deutschland, wo Grenzen zwischen Fürstentümern, Herzogtümern, freien Städten für sie einfach nicht existierten, die sie einfach nicht beachtete“ (S. 81f.). Und anstatt, wie so oft, mit Rahel Varnhagen zu beginnen, werden die Schriften von Hanna Katz, Bella Hurwitz, Rahel Rausnitz, Rebekka Tiktiner und Roesel Fischel aus dem 16. und 17. Jahrhundert gewürdigt. Über Fanny Lewald heißt es, für den deutsch-jüdischen Zusammenhang in seiner Verbindung mit dem Ringen um die Gleichberechtigung der Frauen repräsentiere ihr Werk (26 Romane, 43 Novellen, 36 autobiographische Schriften und 40 Artikel) einen wiederzuentdeckenden Schatz (S. 113f.) und mache sie zu einer würdigen Nachfolgerin der Glückel von Hameln.
Gelegentlich hätte Stern den Zorn der behandelten Autoren auf sein Haupt ziehen können, so im Falle Hugo von Hofmannsthals, den er zu den jüdischen Schriftstellern zählt (S. 133, 139, 206). Hofmannsthal empörte sich 1922, als Willy Haas aufgrund des kläglichen Achtels (ein jüdischer Urgroßvater väterlicherseits) einwn Essay über ihn in Juden in der deutschen Literatur publizierte, was zum Bruch mit Haas führte.
„Zahlen erzählen keine Geschichte, das können nur Menschen“ (S. 152). Allerdings sollten wir die deutsch-jüdische Kulturerfahrung nicht der Vergangenheit überlassen, sonst würde Hitler doch noch endsiegen. Wenngleich die jüdisch-deutsche Wechselwirkung nicht mit den Deportationszügen zu Ende war, war nicht abzusehen, daß der Diskurs so schnell nach Erscheinen des Buches neue Formen annehmen würde. Stern hatte seine Zielsetzung folgendermaßen definiert: eine skizzenartige Zeichnung anzubieten um „die deutsch-jüdische Erfahrung von der Mitte der deutschen Gesellschaft und nicht vom Rand zu lesen“ (S. 216). Angesichts der Debatte vom Sommer 2002 muß gefragt werden, ob wir jetzt nicht erst recht um den Schlaf gebracht werden und das Buch nicht schon ein schmerzhaftes Zusatzkapitel nötig hätte.