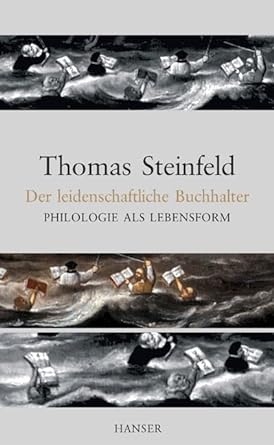Als „trockener Schleicher“ erscheint der Famulus Wagner seinem Idol Faust, und unter den vielen philologiekritischen Sätzen Friedrich Nietzsches steht auch dieser: „Der größte Teil jener Ameisenarbeit ist einfach Unsinn und überflüssig.“ Freilich ist diese Verurteilung der Textwissenschaft der Nachwelt nur bekannt geworden, weil sie von gewissenhaften Nietzsche-Forschern in die „Nachgelassenen Fragmente“ aufgenommen und veröffentlicht wurde. Denn zum stillen Masochismus des Philologen gehört auch, dass er selbst die Verrisse noch ediert, die ihm zugedacht werden. (Wer will, kann dies freilich auch als Triumph auffassen.)
Natürlich haben die trocknen Schleicher nicht nur ihre Leiden, sondern auch ihre kleinen Freuden: Ein Zitatfehler in der Veröffentlichung eines Konkurrenten kann sie ebenso glücklich machen wie ein unerwarteter Manuskriptfund, eine bisher übersehene Lesart und dergleichen mehr.
In seinem umfangreichen Essay Der leidenschaftliche Buchhalter sammelt Thomas Steinfeld reichhaltiges Material zur Geschichte und zu den Arbeitsweisen des Philologenstandes. Das meiste, was er versammelt, lässt sich – wie gerade geschehen – für eine Psychopathologie des Philologischen verwenden. Ganz in Steinfelds Sinn ist diese kritische Pointierung allerdings nicht. Er verkündet nämlich eine Botschaft, die man beim derzeitigen Stand der medialen Entwicklung wohl als „frohe“ auffassen soll: In unterschiedlichen Formulierungen beteuert Steinfeld immer wieder, dass die Philologen gar nicht jene abgehobenen, elitären Spinner sind, für die sie in der öffentlichen Meinung gern gehalten werden. Denn die Philologie hat – so seine entscheidende These – „als Lebensform“ breite Kreise der Gesellschaft erfasst:“Die gesammelten Werke eines Filmregisseurs, einer Schauspielerin oder eines berühmten Ensembles der populären Musik, die Produkte einer besseren Autofabrik oder eines geschickten Uhrmachers werden heute mit nicht weniger Akribie und Sachverstand kommentiert als die eines großen Dichters, komplett mit Vorwort, biographischen Anmerkungen, Echtheitskritik, Faksimiles, Überlieferungsgeschichte und allem anderen Zubehör, das ein wissenschaftlicher Apparat verlangt.“
Vor diesem Hintergrund kann Steinfeld der Philologie also eine gewisse popkulturelle Qualität zuschreiben. Dabei ist er nicht blind für die Unterschiede, die zwischen einem Literaturarchiv oder einem germanistischen Institut einerseits und einem „Mecki-Fanclub“ andererseits bestehen: Zumindest institutionell abgesicherte Germanisten leben von ihrer Arbeit, was darauf schließen lässt, dass sie als gesellschaftlich nützliche anerkannt ist. Die dilettantischen Liebhaber diverser Subkulturen zahlen hingegen dafür, dass sie ihr Hobby ausüben dürfen. Dennoch haben die philologischen Profis und die philologisierenden Dilettanten die leidenschaftliche Liebe zur Buchhalterei gemeinsam, die im Titel von Steinfelds Arbeit angesprochen wird.
Mag sein, dass an dieser These, die Thomas Steinfeld über 247 Seiten hin ausbreitet, „etwas dran“ ist. Doch ließe sich auch eine Geschichte der Philologie denken, die nicht den Titel „Der leidenschaftliche Buchhalter“ trüge, sondern etwa „Die allzeit eifrigen Anpasser“ heißen müsste. Philologen sind, um ein Wort August Wilhelm Schlegels aufzugreifen, „subalterne Talente“, und als solche haben sie sich immer gern an tatsächlich oder vermeintlich stärkere Disziplinen angelehnt. Wie auch Steinfeld weiß, schielte die Textwissenschaft in ihren Anfängen nach der Theologie, später nach der Philosophie, dann nach der Soziologie oder der Linguistik. Und es ist nicht riskant zu prophezeien, dass demnächst die ersten literaturwissenschaftlichen Arbeiten unter Berücksichtung neuester Ergebnisse der Hirnforschung erscheinen werden – falls es sie nicht schon längst gibt.
In dieser Geschichte der immerwährenden Anpassung ans jeweils Gängige hätte auch Thomas Steinfelds Buch einen Platz verdient. Dass man heutzutage in der Öffentlichkeit vor allem dann Gehör findet, wenn man sich mit der populären Kultur gut stellt, ist offensichtlich. Auch deshalb entdecken immer mehr Germanistikprofessoren ihre Liebe zum Fußball, zu Jerry Cotton oder Harald Schmidt. (Nicht hingegen zu Karl Moik oder den „Kastelruther Spatzen“. Auch Entgrenzung hat ihre streng zu beachtenden Grenzen.) Der Feuilletonredakteur Thomas Steinfeld geht einen entscheidenden Schritt weiter in Richtung Populärkultur, indem er die philologische „Ameisenarbeit“ selbst zum Pop-Phänomen erklärt.“
Trotzdem ist schwer vorstellbar, dass Der leidenschaftliche Buchhalter in popig entspannten Kreisen „Kult“ werden könnte. Denn vor allem im historischen Teil seiner Abhandlung schreiten die Sätze des Autors gespreizt, umständlich und langatmig einher, sind also „germanistisch“ im schlechtesten Sinn des Wortes: „Wann den philologischen Disziplinen zum erstenmal Zweifel gekommen sind in ihrem deutschen Glauben an die unvergleichliche Kraft des Ursprungs, wann sie begonnen haben, ihn für den Idealismus zu halten, der er ist – das wird sich nicht ermitteln lassen, zum einen, weil sich die Ablösung allmählich vollzogen hat, im selben Maße, wie es sich weltanschaulichen Fragen zuwandte, wie sich das Fach internationalisierte, wie es ein methodisches Bewußtsein von den eigenen Tätigkeiten entwickelte und die verläßliche Edition nicht mehr als das höchste Ziel ihrer Arbeit galt, zum anderen, weil die Magie des Ursprungs bis auf den heutigen Tag ihre Enklaven innerhalb der akademischen Philologie und ihre Freistätten an den Rändern besitzt.“ Angesichts solcher Satzungetüme fällt es schwer, dem Autor jene „Leidenschaft“ zu glauben, die er im Titel seines Buches auch für sich in Anspruch nimmt.