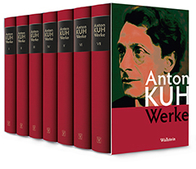Als Anton Kuh (1890 -1941), der österreichische Journalist, Essayist und Erzähler, im Exil, in New York starb, verfasste Franz Werfel einen Nachruf auf den Kollegen, mit dem er mehr als dreißig Jahre verbunden gewesen war; und er schloss diesen Nachruf, indem er die Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass sich „in besseren Tagen eine Hand finden“ möge, die Anton Kuhs „staunenswerte Worte […] sammelt und überliefert“. – Diese Hand hat sich endlich gefunden. Drei FWF-Projekte (2005-2008 und 2010-2013) hat Walter Schübler (unter der Projektleitung von Johann Sonnleitner) dazu genutzt, die bis dahin (wie man erst jetzt weiß) nur in ersten Ansätzen erfolgte bio-bibliographische Grundforschung voranzutreiben, d.h. alle zu Lebzeiten des Autors in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern gedruckten Texte zu sammeln (und angemessen zu erläutern). Schübler, ausgewiesen als Fachmann für Rabelais und Nestroy, konnte dabei auf verdienstvolle Vorarbeiten aufbauen, namentlich auf Ulrike Lehner: Bibliographie Anton Kuh (1890–1941). In: Deutschsprachige Exil-literatur seit 1933, Bd. 4: Bibliographien. Schriftsteller, Publizisten und Literatur-wissenschaftler in den USA. Hg. v. John M. Spalek, Konrad Feilchenfeldt und Sandra H. Hawrylchak, Teil 2 (H–M). Bern, München 1994, S. 1019–1049; sowie Elisabeth Nürnberger: Anton Kuh. Ein österreichischer, jüdischer Journalist und seine politische Berichterstattung in der Zwischenkriegszeit und im Exil. Phil. Diss. Wien 1989.
Aber er konnte zu den bisher bekannten (ca.) 750 Drucken (die später z. T. in diversen Sammelausgaben nachgedruckt worden sind) schließlich noch einmal so viele eruieren: Die Werke in sieben Bänden enthalten nun rund 1500 Erstdrucke und weisen darüber hinaus ca. 400 Zweitdrucke nach.
Die Entscheidung, alle diese Texte ungekürzt in einer kritischen Studienausgabe herauszubringen (auch mit einigen – wenigen – Wiederholungen), ist ohne jeden Vorbehalt zu begrüßen. Anton Kuh, dessen Feuilletons und Stegreif-Reden in Prag und in Berlin ebenso Gehör gefunden haben wie in Wien (wo er zur Welt gekommen ist), hat keineswegs nur Schnurren, Satiren und andere Boshaftigkeiten publiziert. Schon in jungen Jahren folgt er den Spuren seines Großvaters David Kuh und seines Vaters Emil Kuh, auch er wird Journalist; und ist unglaublich selbstbewusst und stilsicher von allem Anfang an. Sein erster Text, ein Wiener Theaterbrief, abgedruckt im Montagsblatt aus Böhmen 1908, verrät schon, was seine Arbeiten für Zeitungen und Zeitschriften generell auszeichnet: Kuh nimmt sich kein Blatt vor den Mund, wenn er über Schriftsteller/innen oder Schauspieler/innen urteilt, denn er kennt seine Pappenheimer, er ist belesen, er hat (manchmal sonderbare, aber immer nachvollziehbare) Kriterien und bietet regelmäßig weit mehr als bloße Geschmacksurteile. Er vertraut auf seinen eigenen Kompass, aber er scheut sich nie, in seinen Argumentationen offenzulegen und auch zu reflektieren, von welchen Normen er ausgeht und welche „Diskussionsweisheiten“ ihm missfallen. Wo immer er nüchterne Betrachtungen vermisst, greift er ein, wie in seinem Epilog zu den Lueger-Nachrufen, den er kühl mit der Bemerkung abschließt, der Bürgermeister habe „die Dummheit repräsentationsfähig gemacht“. Aber nicht nur in seinen Nachrufen (u.a. auf Kaiser Franz Joseph, Émile Verhaeren, Walther Rathenau, Hugo Bettauer und Walther Rode), auch in den scheinbar ganz schnell hingeworfenen feuilletonistischen Bagatellen bemüht er sich immerfort, ein Schlaglicht auf seine Zeit zu werfen.
Während er die da oben eher aus großer Distanz beobachtet, macht er kein Hehl daraus, wem er seine Sympathien schenkt. Sie gelten dem philosophischen Müßiggänger, der hin und wieder seufzt, das Leben sei eine Kettenbrücke, und auf die Frage, wie denn das jetzt zu verstehen wäre, auch keine Antwort findet: „Weiß ich?“ Sie gelten Persönlichkeiten, die nie daran gedacht haben, ihren Lebenshumor aufzugeben; Paul Schlenther z.B., dem Ibsen-Kenner und Direktor des Hof-Burgtheaters, den man in Wien nicht sonderlich geschätzt hat. Sie gelten vor allem jedoch der Literatur, sofern sie, zumindest doppeldeutig, jede einseitige Position durchkreuzt. So wie er’s selber gerne hält, wenn er z.B. Mödling eine Kurzcharakteristik widmet, diesem „Städtchen, das der deutschen Literatur Männer wie Anton Wildgans und Franz Theodor Csokor gegeben hat, am Fuß des Anninger gelegen und in nächster Nachbarschaft des Gumpoldskirchner Weines“ … eine Charakteristik die doch recht unterschiedliche Lesarten erlaubt.
Zahlreichen Autoren widmet er vielsagende Porträts, Ibsen, Strindberg, Wedekind, in den 1930er Jahren dann auch „Emigranten“ aus früheren Epochen, Börne, Heine, Dostojewski; einigen widmet er hingegen nur einen Satz: Georg Trakl zum Beispiel. Sogar solche Sätze aber wirken jederzeit aussagekräftig. – Mit den Kritikern, die es versäumt haben, nach Kafkas Tod mit einer angemessenen Würdigung zu reagieren, geht er scharf ins Gericht; man werde später einmal ganz bestimmt, schreibt Kuh in deren Stammbuch, „Zusammenhänge zwischen seinen Dichtung gewordenen Traumberichten und der Psychoanalyse aufdecken“ und Kafka neben Heinrich von Kleist stellen. Sehr früh schon setzt er sich für Ödön von Horváth ein, auch für Luigi Pirandello (von dem er allerdings wieder abrückt, als bekannt wird, dass Pirandello von Mussolini regelrecht fasziniert ist).
Mit manchen Zeitgenossen dürfte er es sich ein für alle Mal verscherzt haben: ganz bestimmt mit dem (seinerzeit bekannten) Dramatiker Hans Müller-Einigen und dessen Bruder Ernst Lothar, auch mit Felix Salten, Franz Blei und Arnolt Bronnen. Sogar der Nobelpreis für Literatur kann ihn nie und nimmer umstimmen, wenn er schon einmal sich seine Position zurechtgelegt hat; Henryk Sienkiewicz jedenfalls hat aus seiner Sicht nichts anderes zu bieten als eine bunte „Mischung aus Zolaschem Realismus, Marlittschem Nacheinander und Dumasschen Effekten“. Unentwegt kämpft er schließlich über Jahre hin gegen Karl Kraus und dessen Gefolge, die gesamte „Krausklasse“. – Auch mit Richard Wagner und dessen Hochstilisierung zum deutschen Komponisten par excellence konnte sich Kuh nie anfreunden.
Weit schärfer und interessanter als die allermeisten seiner Anekdoten und Humoresken (die bis dato gleichwohl das Bild dieses Schriftstellers markiert haben) sind seine Auslassungen gegen die Dummheit in allen Fragen der Politik. Ein Gusto-Stück in dieser Hinsicht ist seine Antwort auf den (fiktiven) Leserbrief des Mathias Wamperl aus Wien-Margareten, der noch im Oktober 1918 felsenfest an die „granit-harte Monarchie“ glaubt, die Reichspost abonniert und nach der offenbar bereits verschwundenen Zensur ruft. Härter seine heftige Attacke gegen die Wiener Kaffeesieder, die nur „Damen mit Begleitung“ oder „Solchene“ (die ihren Kaffee selbst bezahlen) kennen, also nach wie vor „auf dem Großvater-Standpunkt Schildwach“ halten. Auf das Schärfste aber verfolgt Kuh von allem Anfang an, schon lange vor 1933, alle deutschnationalen / nationalsozialistischen Umtriebe.
In seinen Feuilletons, die u.a. im Prager Tagblatt, im Neuen Wiener Journal, im Pester Lloyd, im Berliner Tageblatt, in der Vossischen Zeitung und im Simplicissimus, im Exil auch in dem von Manfred George herausgegebenen Aufbau erscheinen, wie auch in seinen selbständigen Publikationen (u.a. Juden und Deutsche, Der Affe Zarathustras, Der unsterbliche Österreicher, Physiognomik) werden die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die Verheißungen und die Verwerfungen der Moderne ebenso aufmerksam und kritisch registriert wie literarische Neuerscheinungen (Frank Wedekind, Gerhart Hauptmann, Thomas Mann u.v.a.) und Theateraufführungen oder auch Konzertveranstaltungen. Dabei greift er vielfach Themen auf, die sonst eher selten in den Feuilleton-Seiten zu finden sind; er schreibt über den Geruch der Städte, über Vergnügungen die keinen Kreuzer kosten, über den Klerikalismus, über den Selbstmord eines Kindes (und über die höchst unterschiedlichen Reaktionen darauf). Beinah in jedem Fall nimmt er unumwunden (s)einen Standort ein. Ganz selten nur lässt er sich mitreißen, im Strom der Zeit zu schwimmen; seine Ansichten zum „Großen Krieg“ (sowie zur russischen, französischen und englischen Literatur der Zeit) sind somit als Ausreißer zu sehen, als (allerdings unrühmliche) Sonderfälle.
Dennoch ist das Vorhaben, alle seine (bisher aufgefundenen) Texte nachzudrucken, ohne weiteres zu begründen: Wird doch erst damit das Bild des Autors, das bisher den Bohemien in den Vordergrund gerückt hat, neu gefasst. – A. Kuh hat seinen Leserinnen und Lesern in jeder Hinsicht viel zugemutet; und er konnte wohl auch davon ausgehen, dass sie noch keine Probleme hatten nachzuvollziehen, welche Typen er vor Augen hatte, wenn er die „Timons“ seiner Epoche geißelte (er setzte jedenfalls voraus, dass ihnen zumindest Shakespeares Timon von Athen bekannt war, mehr noch: Shakespeare komplett). Historiker/innen, die sich für farbige Impressionen aus dem Alltag der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts interessieren, erhalten also mit diesen Feuilletons eine Fundgrube ersten Ranges; und Literaturwissenschaftler/innen werden zahllose unfrisierte, originelle Gedanken zu der in dieser Phase erfolgten Entwicklung und Revision des Kanons entdecken.
Schübler ordnet die Texte chronologisch, aus guten Gründen, weil nur so sich der Herausgeber ganz zurückhält; und auch seine Vorkehrungen, die zumeist aus Zeitungen übernommenen Texte druckfehlerbereinigt wiederzugeben, sind wohl-begründet; dass er sich dabei die Mühe macht, Fehler im Bereich der Orthographie und Interpunktion jeweils nach der gerade aktuellen Duden-Auflage zu korrigieren, sei ausdrücklich hervorgehoben. Selbstverständlich verzichtet er auf eine Normalisierung, wo immer eine sprachliche Eigentümlichkeit, eine stilistische Nuancierung offenkundig dem Autor (und nicht einem Setzer) zuzuschreiben ist. Auf Irrtümer, die dem Autor unterlaufen sind, wird im Stellenkommentar explizit hingewiesen.
Dieser Einzelstellenkommentar (Band 7 der Ausgabe) beschränkt sich auf das „Notwendige“ (so Schübler) und umfasst doch mehr als 500 Seiten. Namen (die noch nicht von Wikipedia erfasst sind) werden ebenso aufgeschlüsselt wie schwer greifbare intertextuelle Anspielungen (wobei Werke der Weltliteratur ebenso zu Wort kommen wie Alt-Wiener Volksstücke und die Tradition des Wienerliedes); Dialektausdrücke werden ins Standarddeutsche übertragen („Schamen S’ Ihna!“ dürften die Leser/innen einer 7-bändigen Ausgabe der Werke von A. Kuh allerdings auch ohne Übersetzung verstehen), historische Prozesse werden (oft unter Einbindung zeitgeschichtlicher Dokumente) ausführlich erläutert (z.B. die Entwicklung des Antisemitismus in Wien). – Einzelstellenkommentare sind gewöhnlich staubtrocken; nicht in diesem Fall. Schübler versteht es, nicht nur sachlich fundiert, sondern auch, wo immer das möglich ist, durchaus unterhaltsam seine Leser/innen zu informieren: Zum Stichwort „Beinfleisch“ beispielsweise gibt er nicht nur einen Einblick in die Besonderheiten der Wiener Küche; er liefert gleich auch sachkundige Hinweise auf die österreichische Rindfleischnomenklatur mit.
An den Kommentar, das Glanzstück des siebten Bandes, hat Schübler eine sorgfältige Auflistung sämtlicher Druckorte angeschlossen, ferner ein Verzeichnis der Stegreif-Reden, die Anton Kuh gehalten hat, sowie zuletzt eine Zusammenstellung seiner Rundfunk-Sendungen und Drehbücher. Ein umfangreiches Nachwort und ein Glossar (für Leser/innen, die über Austriazismen stolpern könnten) sowie sieben [!] Register beschließen die Edition. Die Forschung, die künftig darauf aufbauen kann, ist dem Verlag, dem Herausgeber und den Subventionsgebern zu großem Dank verpflichtet.
Im Nachwort fasst Schübler zusammen, was Anton Kuh immer wieder angetrieben hat zu schreiben: wofür er eintritt und wogegen er polemisiert, ein Journalist, der sich nie bedeckt gehalten hat, der bei ambitionierten Zeitungsprojekten mitarbeitet, aber auch bei eher windigen Boulevardblättern, um ein Leben führen zu können, das Alma Mahler wohl nicht ganz unzutreffend als „geradezu selbstmörderisch“ bezeichnet hat.
Gewiss, über viele Texte, die Anton Kuh zwischen 1908 und 1941 publiziert hat (seine letzten Arbeiten sind im Aufbau erschienen), ließe sich nach wie vor trefflich streiten. Schübler indes verzichtet darauf, allzu streng mit seinem Autor ins Gericht zu gehen. Stattdessen hält er ihm zugute, was immer seine Position im zeitgenössischen Literaturbetrieb vorteilhaft herausstreicht: wie der antibürgerliche Habitus in einem Umfeld, in dem in erster Linie Beamtenseelen und Bildungsphilister das Sagen haben, oder der Kampf gegen den Antisemitismus und gegen den Nationalsozialismus, schon in einer Phase, in der nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sich noch sehr zurückhalten, um ihre Stellung in der österreichischen Literaturlandschaft nicht unnötig zu gefährden.
Schübler hat es sich auch erspart, Einwendungen von prominenten Zeitgenossen gegen Anton Kuh aufzunehmen und sich damit (kritisch) auseinanderzusetzen. Klaus Mann, um hier nur ein Beispiel anzuführen, zeichnet in seinem Lebensbericht Der Wendepunkt beispielsweise ein ganz anderes Bild von A. Kuh als Schübler; andererseits jedoch: Niemand kennt die Biographie und das Werk von Anton Kuh so genau wie der Herausgeber; Franz Werfel hätte ihm, nach der Lektüre dieser sieben Bände, bestimmt einfach stumm und ohne irgendetwas noch zu entgegnen die Hand gedrückt.
Denn die Ausgabe ist vorbildlich eingerichtet und darf künftig als Musterbeispiel für Studienausgaben gelten; Kommentar und Nachwort sind methodisch völlig einwandfrei ausgearbeitet und durchaus geeignet, eine ganz neue Sicht auf die Bedeutung dieses Werkes anzuregen. Walter Schübler verhilft somit Anton Kuh nachgerade zu jenem Status, den der Feuilletonist im Kontext der österreichischen Kulturgeschichte (keineswegs nur aus der Sicht Werfels) immer schon verdient hätte.