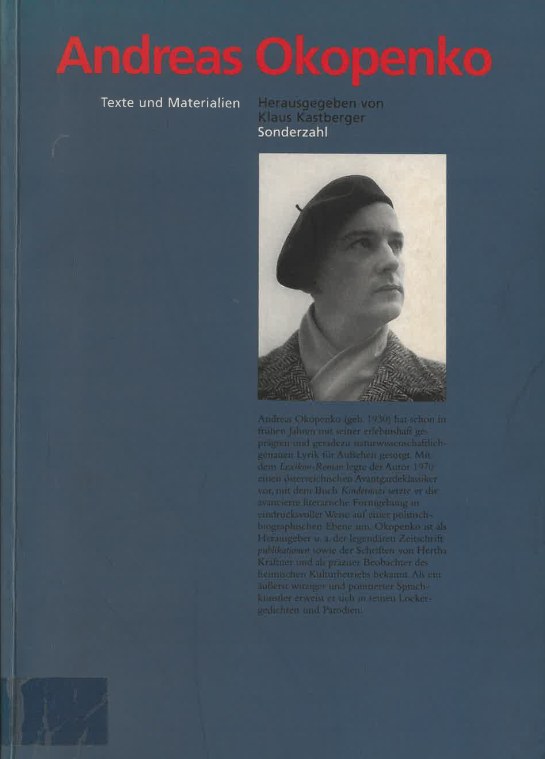Klaus Kastberger, Germanist in Wien, hat nun – als Ergebnis eines Okopenko-Kolloquiums in der „Alten Schmiede“ – eine Sammlung mit Texten und Materialien herausgegeben, die als Anstoß zur (neuerlichen) Beschäftigung mit Okopenko dienen kann. Neben wissenschaftlichen und essayistischen Beiträgen zu Person und Werk enthält der Band auch einige Beiträge des Autors selbst. Zunächst wird der Leser auf biografische Spuren geführt: Die „Sprachzerrüttung“ (S. 9), die das Kind in den Karpaten unter Deutschen, Ukrainern, Slowaken, Tschechen, Juden und Zigeunern erfuhr, verweist ebenso auf die spätere literarische Tätigkeit wie seine „Erzählhemmung“ (S. 13) oder die „naturwissenschaftlich protokollarische Gesinnung“ (S. 15). Weiters: Okopenko als „Kindernazi“ während des Zweiten Weltkrieges; danach als „Weltverbesserer“ (S. 19); als angehender Lyriker in der Zeit der Beschäftigung mit Whitman, Eliot, Trakl, Verhaeren; die Krisenjahre mit dem „Kampf um die Wiedergewinnung des positiven ‚Inmitten‘-Gefühls à la Whitman“ (S. 22); dann wiederum die Erfahrung der Sprachkritik der neuen Dichtung; schließlich die endgültige Etablierung zum freien Schriftsteller.
Dem mit diesen biografischen Hinweisen „ausgerüsteten“ Leser eröffnen sich in den folgenden Aufsätzen Einblicke in das literarische Werk: Anhand der Gedichte der fünfziger Jahre erläutert Wendelin Schmidt-Dengler ein poetisches Verfahren, das auf bemerkenswerte Art subjektives Erleben mit zeitgeschichtlichen Fakten kombiniert. Franzobel erfreut sich an Okopenkos „Akazienfresser“, einem satirischen Rundumschlag gegen dessen literarische Kollegen (von Rilke bis Wolfgang Bauer), der durch „lockere Aufbruchstimmung“ (S. 57) und „beinahe dadaistische Leichtigkeit“ (ebd.) besticht.
Im Zentrum des Bandes dann Okopenkos „Drei theoretische Texte aus den fünfziger Jahren“, die einen frühen Versuch darstellen, Kunst bzw. Dichtung und die eigene Aufgabe als Schriftsteller zu definieren. Der Autor grenzte sich da mit „Grundsätzen“ wie „Kunst ist gefühlserregende Mitteilung von Gefühlserregendem“ (S. 61) oder „Der Künstler aber […] wird die Einheit der Welt […] ausdrücken wollen“ (S. 62) deutlich von den meisten seiner „modernen“ Zeitgenossen ab. Seiner „Poetik des Fluidums“, sozusagen die Grundessenz der Okopenkoschen Dichtung, ist Daniela Petrini in ihrem Aufsatz nachgegangen: „Das Fluidum läßt uns das Wesen der Welt ahnen, ihr Allgemeines und ihre stetige Besonderung. […] Wir gewinnen Zusammenhang […], unser Leben wird aus etwas Dumpfem zu einem Plan […]“ (S. 71). Okopenkos Dichtung ist der Versuch einer Umsetzung dieses existentiellen Erlebens in Sprache, einer „dem einmaligen Augenblick spezifisch entsprechenden Darstellung“ (S. 70). Und Okopenko glaubt an die Mitteilbarkeit der „erweiterten Wirklichkeit“ (S. 90), wie er auch davon überzeugt ist, daß „wir mit unseren Sinnesorganen und unserem Gehirn […] ziemlich viel von der ‚echten‘ Wirklichkeit erfassen“. (ebd.)
Dem „Lexikonroman“, diesem „österreichischen Avantgardeklassiker“ (S. 9), ist der Beitrag Klaus Kastbergers gewidmet. Der Roman, dessen „Material“ (Personeninventar, Orte, Gegenstände, Ereignisse etc.) alphabetisch angeordnet ist, überläßt dem Leser – durch Beachtung oder Nichtbeachtung der lexikonartigen Verweise – die tatsächliche Anordnung der Elemente, gleich einem Baukasten, dessen Teile man beliebig kombinieren kann. Die dennoch vorhandene Grundstruktur, der „rote Faden“ des Romans, bezieht sich auf ein tatsächliches Erlebnis Okopenkos, das der Leser im „Protokoll einer Donaufahrt vom 18.Juni 1968“ nun erstmals nachlesen kann. Kastberger sieht in diesem Roman eine konsequente Anwendung der schon für die Lyrik konstitutiven „Poetik des Fluidums“ (die „Darstellung von Realität in möglichst konkreter Weise“; S. 90) und zwar nicht nur aufgrund der realistischen Elemente (eigene Beobachtungen, Gesprächsfetzen, Werbematerial, Buchzitate etc. – Okopenko hat dies alles in „naturwissenschaftlicher“ Manie zusammengetragen), sondern auch oder gerade wegen der formal experimentellen Form, die dem linearen Erzählen eine Absage erteilt und „gleichsam die bessere Methode realistischen und konkretionistischen Erzählens“ (S. 92) ist.
Formal ebenso ungewöhnlich ist Okopenkos autobiografisches Werk „Kindernazi“, das die Jahre 1939-45 beschreibt und darin einer umgekehrten Chronologie folgt: Die Erzählung schreitet vom Ausgangspunkt 1945 zurück bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Dadurch wird – im Gegensatz zu den meisten anderen Autobiografien – eine „chronologische Logik“ vermieden. Auch inhaltlich unterscheidet sich „Kindernazi“ von herkömmlichen Denk- und Beschreibungsmustern, indem es etwa „politisch korrekte“ Leseerwartungen nicht erfüllt.
Vom literarischen mainstream sind solche Werke weit entfernt. Ein „Lockergedicht“ mit dem Titel „Autobiographisch“ lautet: „Ich bin ein Messer namens NEIN / geh unbemerkt durch eure Reihn“. Der vorliegende Band bietet nun Gelegenheit, genauere Einsichten in das Werk des (meist) unbemerkten und messerscharfen Dichters zu erhalten. Die Auswahlbiographie im Anhang erleichtert eine weiterführende Beschäftigung.
Daß sich diese lohnt, davon zeugen die Beiträge des Buches. Otto Breicha: „Man muß natürlich ‚auf den Geschmack kommen‘.“