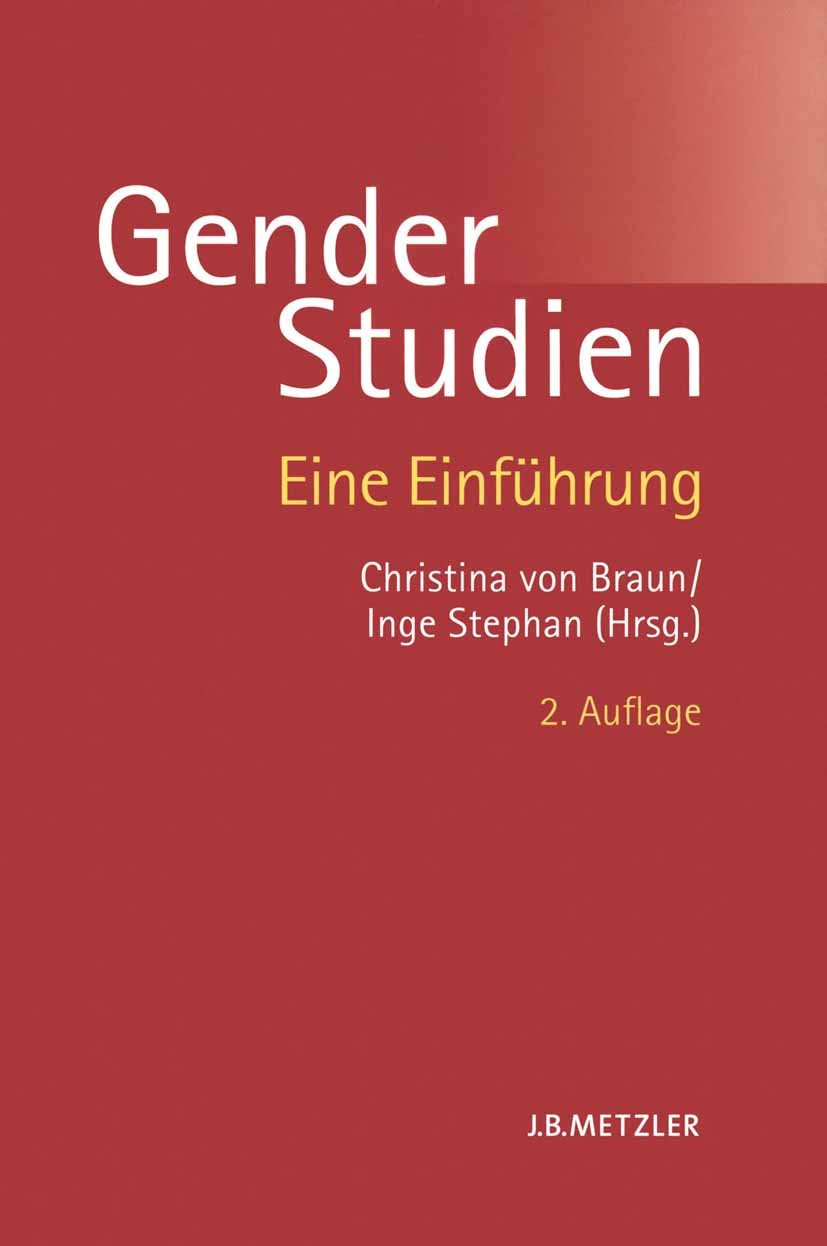Christine de Pizans „Buch von der Stadt der Frauen“, welches Solches berichtet, ist schwerlich unter die Verständigungstexte der Women’s Lib zu rubrizieren – erschien es doch am Ausgange jenes Mittelalters (1405), das wir das „dunkle“ zu nennen belieben. Gewohnt, den beständigen Zuwachs an Aufklärung und Licht selbstgewiss auf die Konten der Moderne zu verbuchen, denken wir alle Schritte als Fort- und jede Bewusstseins-Levitation als linear. Wie jedoch in den Verwerfungen unserer Unbewusstheiten, in der Diätetik unserer Empfindungen, in den Falten unserer Institutionen so mancher Herzschlag mittelalterlicher Finsternisse pocht, prangerte nicht nur der militante Feminismus der 70er Jahre an, sondern erforscht, in abgeklärter Gefolgschaft, der polymorphe und mit reichem methodischen Instrumentarium ausgestattete wissenschaftliche Komplex der Gender Studies. Mit dem von Christina von Braun und Inge Stephan herausgegebenen Einführungswerk liegt nun ein spezifisch auf die Forschungslandschaft Deutschlands (leider fehlen die Schweiz und Österreich) zugeschnittenes Kompendium vor, welches nicht nur Genese und Gegenstand der Geschlechterforschung ausführlich erläutert, sondern auch kollaterale Agenden in den Einzelwissenschaften erschöpfend portraitiert: Ein Standardwerk, welches nicht nur frauen- und männerforschenden Wissenschaftern und Studenten auf die Leselisten zu wünschen wäre.
Ausgehend vom linguistischen Kopfzerbrechen darüber, wie die lexikalisch-grammatische Kategorie des „Geschlechtes“ („gender“) eines Wortes zum biologischen Geschlecht („sex“) von Lebewesen in Beziehung zu setzen sei, fokussierte sich bald der Blick auf das lateinische Verbum „generare“, „erzeugen“ – all so waren die Gender Studies als Forschungen im Reiche der Erzeugung von Bedeutungen und Deutungen geboren. Verfügt die deutsche Sprache nur über das eine und ungeschlachte Substantiv „Geschlecht“, ermöglichte das in dieser Hinsicht differenziertere Lexik des anglo-amerikanischen Sprachraums eine Differenzierung in „sex“ (als biologisches) und in „gender“ (als „soziales“ Geschlecht). Nach dem Prinzip des Politischen, das stets auch privat und des Privaten, das stets auch politisch sei, erkunden die Gender Studies die Ubiquität „geschlechtlich“ bestimmter oder wahrgenommener Dispositive in den verschiedensten Handlungs- und Spielräumen menschlicher Vergesellschaftung: Um Mädchen-, Männer- und Jungenforschung erweitert, transzendieren die Gender-Studies gewissermassen den ursprünglich rein feministisch orientierten Impuls. Darüber hinaus und strukturell analog sprengen sie die thematischen und methodischen Korsette der Separatwissenschaften auf und wenden sich inter- (oder, wie es neuerdings heisst) transdisziplinären Beobachtungsfeldern zu.
Was in der US-amerikanischen Campuswissenschaften seit den 80er Jahren gang und gäbe (und mittlerweile auch schon wieder im Zuge des „political-correctness-bashing“ Objekt neokonservativen Feixens geworden ist), hat erst in Laufe der 90er Jahre an einigen deutschen Hochschulen institutionellen Niederschlag gefunden: Verfügt die Bundeshauptstadt immerhin über drei Zentren für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung (Humboldt und Technische Universität, Hochschule der Künste), so bieten rund ein Dutzend deutscher Universitäten entsprechende Studiengänge bzw. Graduiertenkollegs an. Geschlechterforschung zu studieren sei, so Christina von Braun, „nur dann sinnvoll, wenn es gelingt, die Querverbindungen zu begreifen, die zum Beispiel Philosophie mit den Naturwissenschaften, Kunstgeschichte mit Medizin, Literatur mit Rechtswissenschaft und Theologie mit den Sozialwissenschaften verbindet“. Die profilierte Kulturtheoretikern führt in einem furiosen Essay über „Gender, Geschlecht und Geschichte“ prompt vor, wie sich ein nachgerade Humboldtscher Universalismus „geschlechterdings“ (Gerhard Rühm) zu bewähren hätte: Es werden in atemberaubendem Tempo die Zeiten und Räume der griechischen, jüdischen und christlichen Kultur-Geschichte(n) durchquert, um darzulegen, wie der weibliche (später und nach dem selben Prinzip auch der androgyne, der schwule und der jüdische) Körper in vielerlei Hinsicht marginalisiert, bemächtigt und zum passiven Objekt männlich codierter Diskurse und Machinationen transformiert worden ist. Christina von Braun verflüssigt die erstarrten Oppositionen von „männlich“ (als Symbolgestalt des Geistigen, der Ratio, der Kultur, des Aktiven) und „weiblich“ (als Symbol für das Körperliche, die Gefühlswelt, die Natur, das Passive) in einer atemberaubenden Kaskade historischer Läufe und Verläufe, als deren Wasserscheide die Entstehung der Schriftkultur figuriert. Schlüssig wird, wie aus dem abstrakten, linearen Aufzeichnungssystem einerseits die demokratische Verfassung koaguliert, andererseits die Entwertung der zyklisch-natürlich-„körperlichen“ Zeitkonzeption entspringt. Die bemächtigende Unterwerfung der weiblichen Körper-Natur wird am plausiblesten dort, wo das vom vermeintlich Gesunden und Vernünftigen Abweichende qua Pathologisierung in die medizinische Zuständigkeit abgeschoben wird: Am Beispiel der Konjunktur der von Hippokrates aus der griechischen Bezeichnung für Gebärmutter abgeleiteten „Hysterie“ wird offenbar, wie prominent die Präokkupation mit den Scharnierstellen zwischen Körperbild und Subjektkonstitution (sowohl im Denken um 1900 als auch in der postmodernen Theoriebildung) geworden ist. Die seit Mitte der 80er Jahre vornehmlich im anglo-amerikanischen Raum entwickelten Entwürfe von androgynen und wandelbaren Subjekt-Körpern revoltieren gegen jene Deutungsmonopole, welche in Medizin, Recht, Verwaltung und Wissensformierung bislang über „männlich“ und „weiblich“, bzw. „normal“ und „deviant“ entschieden haben. In der Utopie der Transsexualität konvergieren Gay Studies, Judith Butlers Negation der Relevanz des natürlichen Geschlechts („Gender Trouble“, 1990) und Donna Haraways „Manifest für Cyborgs“ (1995).
Wem bei dieser rasenden Fahrt auf den Braunschen Argumentations-Katarakten ein wenig schwindlig geworden ist, der mag sich erleichtert in die – fast – durchwegs in ruhig-souveränem Ton gehaltenen Darstellungen der „gender“-Forschungssituation in den Einzeldisziplinen begeben: Die Referate zu nicht weniger als siebzehn Wissenschaftszweigen zeigen, wie das Thema „Geschlechterforschung“ vielerorts Anstoss zu fundamentalem Rethinking gab. Dies gilt auch und gerade dort, wo es sich um jene Disziplinen handelt, welche im Bewusstsein der Laienöffentlichkeit kaum existieren (etwa Agrarwissenschaft oder Mathematik). So schiesst diese konzertierte Anthologie von Einzeldarstellungen auf hoch erfreuliche Weise weit über das selbst gesteckte Ziel hinaus, „eine Einführung“ – so der Untertitel – in die Gender-Problematik abzugeben: Die Sammlung liest sich als faszinierende Enzyklopädie zu Geschichte, Struktur und Problembewusstsein der akademischen Wissenschaften. In summa findet sich da manche Übereinstimmung, gleich, ob es sich um den sozialpolitischen Aufbruch der Wissenschaften um 1968, um die Auswirkungen poststrukturalistischer Theoreme seit etwa 1980, um Medien-, Vernetzungs- und Globalisierungsdebatten der 90er Jahre oder um die aktuelle Reflexion der philosophischen und ethischen Implikationen der Reproduktions- und Gentechnologie handelt. Nebenbei erweist die Zusammenschau der vielen Disziplinen und Forschungsrichtungen, wie relativ viel öffentlichen, feuilletonistischen Raum sich die naturgemäss beredten – mitunter gar geschwätzigen – Geistes-, Geschichts- und Sozialwissenschaften verschaffen, wohingegen die Mathematik, die Musikwissenschaft oder die Rechtsphilosophie ihre Agenden weitgehend in den toten Blickwinkeln der Markt- und Gemeinplätze verfolgen. So lehrt dieser Reader auch, das Geschrei, welches die Protagonisten der Künste und Geisteswissenschaften in periodischer Wiederkehr um die angebliche „Marginalisierung“ ihrer Forschungs- und Lehrbereiche anstimmen, künftig mit Vorsicht zu geniessen. Es wird allerdings auch – quer durch die Disziplinen – bewusst, welch hohes Prestige derzeit die progressiven und projektiven Branchen von Biotechnologie und Nano-Engineering geniessen: Unwillkürlich stellt sich bei solcher Lektüre die Frage, wie sehr diese unsere, auf ihre post- Post-Modernität so stolze, Epoche darin womöglich jenem späten 19. Jahrhundert ähnelt, welches sein Selbstbewusstsein auf Naturwissenschaften und Ingenieurkünsten errichtet hatte. Ceterum censeo – es sei nicht verschwiegen – dass die Berichte aus allen siebzehn Wissenschaften unisono davon zeugen, wie rar die weiblich besetzten Professuren an deutschen Universitäten bis heute sind: Laut Deutschem Hochschulverband betrug deren Quote im Jahr 1998 zwischen 8,5 und 10% (etwa 3.600 von insgesamt rund 37.000 Stellen).