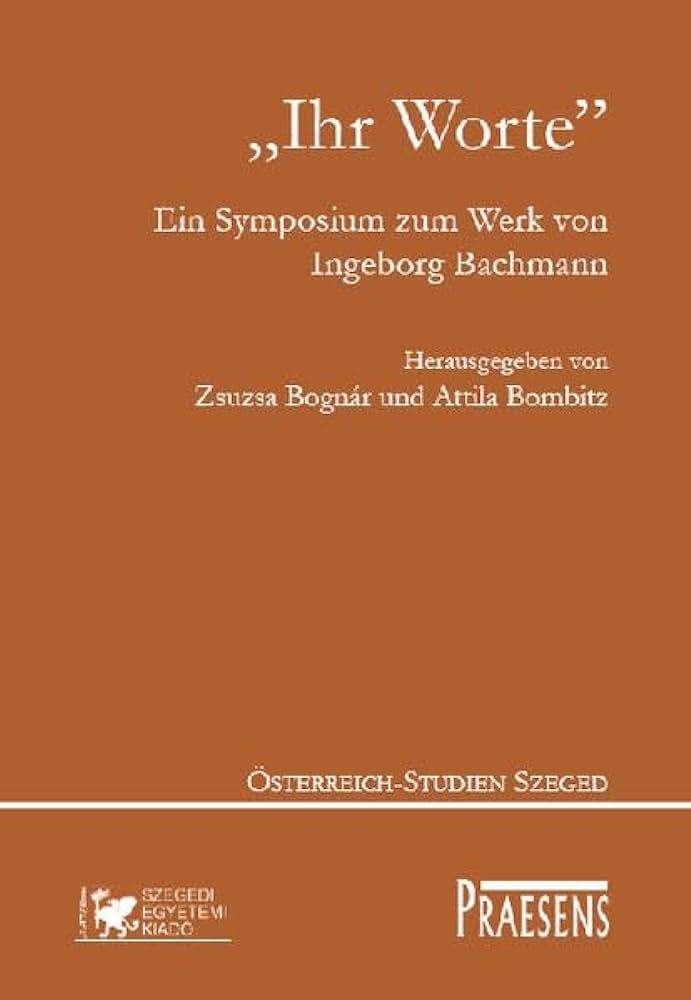Und dieses wird nicht nur im deutschsprachigen Raum viel beachtet, wie etwa jüngst wiederum ein gemeinsames Projekt der beiden ungarischen Universitäten Szeged und Piliscaba bezeugt. Dieses Unternehmen, dessen Beiträge im vorliegenden Sammelband dokumentiert werden, verdient vorweg aus zwei Gründen Sympathie, einmal, weil es, jedenfalls tendenziell, philologische Textnähe sucht. Das verspricht schon der Titel Ihr Worte, der eines der meistzitierten Gedichte Bachmanns apostrophiert und damit auch einen inhaltlichen Schwerpunkt des Projekts markiert: Sprachreflexion und Poetologisches. Ein weiteres Mal, weil neben Aufsätzen ausgewiesener Kennerinnen und Kenner der österreichischen Literatur solche von Studierenden beider Universitäten stehen, die in das Projekt eingebunden waren. Wenngleich der eine oder andere dieser Beiträge noch der (vor allem sprachlichen) Überarbeitung bedurft hätte, finden sich doch in ihnen einige erfrischende Ansätze für neue Zugänge zum Werk der Dichterin.
Ganz im Trend der Bachmann-Forschung seit den späten 1970er Jahren allerdings bewegt sich der vorliegende Band insofern, als knapp die Hälfte seiner insgesamt 18 Aufsätze den Todesarten-Komplex und die Simultan-Erzählungen ins Zentrum des Interesses stellen. Die Interpretation der titelgebenden Figur des Romans Malina bereitet seit dessen Erscheinen Schwierigkeiten. Unterschiedliche Lesarten können durchaus Plausibilität beanspruchen. Dana Pfeiferová, die sich sehr kompetent der „Todesmetaphorik bei Ingeborg Bachmann“, der romantischen („Kehrseite der Liebe“) wie existentiellen widmet, beobachtet, dass im Gegensatz zu den anderen Werken der Autorin in Malina die Täter-Opfer-Polarität nicht eindeutig ist. Sie begründet dies, Gudrun Kohn-Waechter folgend, damit, dass der Tod der Ich-Erzählerin nicht als „Opfer für die Kunst“ zu deuten sei und die Figur Malina keineswegs das „Weiterschreiben“ garantiere, dass vielmehr eine spezielle Souveränität der weiblichen Stimme unabhängig von Malina gewonnen werde.
Demgegenüber sieht Hajnalka Nagy, die sich erneut dem in Bachmanns Werk bekanntlich so wichtigen Spiegelmotiv widmet, dem Roman als Telos eingeschrieben „die Geburt eines autonomen Erzählers, der geschlechtlich nicht mehr fixierbar ist“. Man mag die von Pfeiferová postulierte Souveränität der weiblichen Stimme bezweifeln, in Frage stellen kann man allerdings auch Nagys Auffassung von der Objektivität der gewonnenen Erzählinstanz, die aber immerhin zweifellos als „letzte“ gelten muss im fertigen Roman sowohl als auch – Äußerungen der Autorin zufolge – in ihren Plänen für weitere Todesarten-Texte. Als „Scheitern“ des weiblichen Ichs zwischen den zwei männlichen „Sprachmöglichkeiten“ Ivan und Malina deutet Mihály Arany den Schluss des Romans, ohne allerdings eine Antwort auf die Frage der Erzählinstanz zu versuchen. Diese unterschiedlichen Positionen machen erneut und ja durchaus im Sinne der Autorin (siehe oben) die Unmöglichkeit deutlich, eine Lesart als die einzig gültige festzuschreiben – das macht auch die Faszination von Malina aus, dass sich der Roman in keiner Interpretation erschöpft, dass ein eindeutiges Verständnis der Titelfigur sowie des Schlusses verweigert wird, weil Bachmann an eine Grenze des sprachlich Mitteilbaren zu gehen versucht.
An die Grenze des (jedenfalls in wissenschaftlich logischer Sprache) Sagbaren geht die Autorin auch in der Darstellung der Angst, wie Andrea Horváth an Malina und dem Franza-Fragment nachweist, in denen Angst zwar reflektiert wird, aber eben nicht wissenschaftlich erfassbar ist. Dem entspricht auf der Darstellungsebene der Texte die „Sprechweise“, verstanden als „eine Art Artikulationsort der Angst“, und die Fragmentarität des Schreibens in einer Sprache, die nicht als „eigen“ erfahren wird. Dazu passt auch die schon angedeutete Beobachtung von Mihály Arany, der in vielen Werken der Bachmann, speziell auch in Malina, ein „Konzept der Unmöglichkeit“ der Sprache beobachtet.
Einen überraschenden intertextuellen Bezug stellt Dominika Kurali her, die dem „Opfermotiv“ in Malina nachspürt und in der „Erlösergestalt“ der Legende Parallelen zur Leidensgeschichte Christi sieht. So etwa in der Verwundung durch einen Dorn. Das überrascht insofern, als eben dieses Motiv in der bisherigen Forschung als deutlicher Celan-Bezug unbestritten ist. Kurali erwähnt diese Deutung nicht einmal, begründet daher auch nicht, warum sie mit einem Federstrich Christus an die Stelle von Celan setzt, dessen Bedeutung für die befreundete Dichterin im übrigen von Patricia Broser erneut unterstrichen wird. Sie erkennt nicht nur schon sehr früh „Utopisches im lyrischen Sprechen“ der Bachmann, sondern auch Anfänge der „poetischen Korrespondenzen“ (Böschenstein/Weigel) zwischen der Autorin und Celan. Und auch Antonia Opitz, die sich den „lyrischen Zwiegesprächen“ mit Brecht, Celan und – besonders ergiebig und in dieser Intensität bislang so nicht gesehen – Achmatowa widmet, spricht Celan durchaus große Bedeutung für Bachmann zu, auch wenn ihr die bisherige Erforschung der intertextuellen Bezüge zwischen den beiden als zu „angestrengt“ erscheint, wodurch der Reichtum dieser Bezüge übersehen werde. Konkret etwa schlägt sie – durchaus überzeugend – vor, das Paris-Gedicht der Autorin nicht nur auf Celan hin zu sehen, sondern auch bezogen auf Hölderlins Hyperion mit seinem Bekenntnis zu Dichtung in „dürftiger Zeit“.
Die Thematisierung von Sprache zwischen Polen von Skepsis und Hoffnung ist bekanntlich im Werk von Bachmann zentral. Die Forschung hat dem Rechnung getragen, so tun es auch, wie gesagt, zahlreiche Beiträge des vorliegenden Bandes unter verschiedenen Aspekten. Ildikó Hidas vergleicht Bachmanns „Sprachauffassung“ mit der Canettis. Hier wie dort beobachtet sie, rekurrierend auf den späten Wittgenstein, die Verabschiedung sprachutopischer Ansprüche, allerdings unterschiedliche Reaktionen, nämlich „Trauer“ bei Bachmann und „Lachen“ bei Canetti. Hidas demonstriert es ansatzweise an der Erzählung Alles beziehungsweise am Irrenhaus-Kapitel der Blendung, es verdiente eine genauere Untersuchung. Anders als sie sieht Miklós Fenyves in der Finalisierung von Alles weder eine Bejahung noch eine Verneinung der durch die Vaterfigur „vormals angeprangerten [alltäglichen] Sprache“ in ihrer „nicht-kommunikativen“ Verwendung zur Anrede an den toten Sohn. So neutral wie dem Verfasser dieses Finale erscheint, ist es aber nicht, „Trauer“ ist ihm zweifelsfrei eingeschrieben.
Erzählungen des zweiten Erzählbandes von Bachmann widmen sich Szilvia Gál und Attila Bombitz. Jene thematisiert ebenfalls Sprachproblematik, nämlich die Frage der „Simultaneität“. Abgesehen davon, dass die Behauptung, es handle sich bei den Frauengestalten des Bandes Simultan trotz aller Unterschiedlichkeiten immer um „die gleiche Frau“, höchst fragwürdig ist (eine Beatrix oder Miranda haben mit Nadja und Elisabeth eher wenig gemein), verdient die Beobachtung der Polyphonie der Titelerzählung („fast wie eine vielstimmige Fuge aufgebaut“) weitere Aufmerksamkeit und ausführlichere Behandlung. Der Mitherausgeber Bombitz umkreist esssayistisch experimentell die Erzählung Drei Wege zum See. An deren Finale erkennt er im Vergleich zum Schlusssatz der Erzählung Das dreißigste Jahr, in dem der Musilsche Möglichkeitssinn aufleuchtet, eine Differenz durch die Restriktion der weiteren Lebensmöglichkeiten Elisabeths, die in ihren sprachlichen Einschränkungen ihren Ausdruck findet. Den scheinbar vielfachen sprachlichen Möglichkeiten der Protagonistin, die viele Sprachen beherrscht, die aber (übrigens wie Nadja in Simultan) in keiner zuhause ist, daher ihre Identitätsproblematik nicht zu „versprachlichen“ versteht.
Die als beispielhaft für moderne Essayistik angesehenen Radio-Essays von Bachmann unterwirft Zsusza Bognár einer sehr genauen Lektüre, schenkt ihre Aufmerksamkeit nicht nur der Musil- und Wittgenstein-Sicht der Autorin (Betonung der Nähe zu Musils ideologieskeptischem Utopiekonzept und der Ableitung sprachphilosophischer Positionen Wittgensteins, ohne in dessen Konzept und in dessen Sinn eine Lösung philosophischer Probleme zu sehen), sondern auch den gestalterischen Kunstgriffen, die die hörspielästhetische Sensibilität der Autorin, aber auch die routinierte Rundfunkredakteurin erkennen lassen. Dem Hörspiel schließlich widmet sich Eleonora Ringler-Pascu, die außer einer Tour d’Horizon über die Forschung zum Guten Gott von Manhattan an diesem drei wichtige Aspekte hervorhebt. Der dritte, der Bogenschlag vom Bombenattentat der Eichhörnchen im Funkstück zum 11. September 2001, scheint etwas weit hergeholt, die beiden andern jedoch sind relevant: die Betonung der intertextuellen Bezüge, die die Verfasserin zur Einsicht gelangen lässt, dass nicht so sehr „die äußeren Umstände“ für den Liebestod verantwortlich sind als vielmehr das „ekstatische Konzept der Liebe“, und besonders der Verweis auf die polyphone Gestaltung des Textes, die eine musikalische Konzeption geradezu herausfordert.
Fast alle Aufsätze des vorliegenden Bandes erweisen sich in der einen oder anderen Hinsicht als anregend für eine Neulektüre der Texte Bachmanns, enttäuschend allerdings sind die Berichte der beiden Übersetzer von Bachmann-Lyrik ins Ungarische, die sich im wesentlichen in einem Loblied auf die Dichterin und in Aufteilungsinformationen erschöpfen. Gerade Übersetzer erweisen sich immer wieder als besonders genaue und sensible Leser, als beste Philologen im eigentlichen Sinne. Daher die Enttäuschung über deren Beiträge im Kontext eines sonst ansprechenden Sammelbandes.