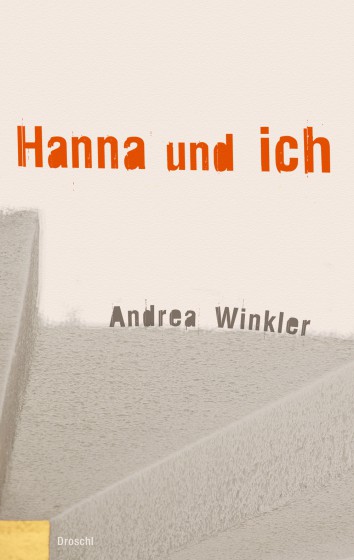„Denen, die ihren Rest suchen gehen“ hat Andrea Winkler ihren ersten Roman gewidmet, der nun im Droschl Verlag erschienen ist. Hanna und ich ist der einfache Titel des Bandes, der schnörkellos auf etwas Kompliziertes hinweist: eine zwischenmenschliche Beziehung. Doch hier ist alles noch etwas verworrener: Was ist los mit diesem Ich und diesem Du?
Wer Winklers Debüt Arme Närrchen gelesen hat, für das die 1972 in Freistadt geborene Autorin mit mehreren Stipendien und Preisen bedacht wurde und mit dem sie auf der Bestenliste von ORF und SWR landen konnte, dem kann das schon bekannt vorkommen. Auch in den Prosaminiaturen des Erstlings hat die Autorin, die in Wien Germanistik und Philosophie studiert hat, sich nicht nur hart an den Grenzen der Sprache, sondern auch der Verlässlichkeit dessen, was wir Wirklichkeit nennen, versucht. So sind die Protagonisten dieser „Selbstgespräche“ schon an gesteigerter Wahrnehmungsfähigkeit, an „chronischer Entgrenzung“ erkrankt, das Ich und das Du als Kategorien brüchig geworden und auch der Boden unter den Füßen „wellt“ sich und ist keine sichere Konstante mehr.
Lassen sich solche sprachspielerischen, surrealen Vexierspiele auch über mehr als eine Länge von jeweils zehn bis zwanzig Seiten durchhalten? Winkler hat es versucht und ist diesen Weg ein Stück weitergegangen. Das Ergebnis ist ein Roman, den man nur als polyphon bezeichnen kann. Nicht nur, dass wieder Zitate von Aichinger über Dostojewski und Blanchot bis hin zu Ringelnatz und Robert Walser in den Text eingeflochten sind, es gibt ohnehin mehrere Figuren die sprechen und sie scheinen seltsam eins zu sein. Winkler mischt die verschiedenen Stimmen zu einem Sample ab, in dem sie einzelne Motive und Bilder scratcht und variiert. Nie kann man ganz sicher sagen, welche Handlung zu welcher Figur gehört. Die Schachteln mit den alten Briefen werden von mehreren Protagonisten aus dem Keller geholt, wem sie gehören, bleibt offen. Und dann gibt es noch eine Erzählerin, die das Erzählte und das Erzählen an sich immer in Frage stellt und ihre Unsicherheit offen zugibt: „Ach, glauben Sie mir nichts, glauben Sie mir alles!“ Der Roman als Blue Box der Erinnerung, als Theater im Kopf: Das Ich und das Du werden zum Feld der Fiktion.
Eine Inhaltsangabe ist ein obsoletes Unterfangen und scheint per se der falsche Ansatz zu sein, der dem Konzept dieser Autorin, die jeden Deutungsversuch sofort kunstvoll desavouiert, nicht gerecht werden kann. Weniges lässt sich sicher sagen: Es geht um Hanna, die einen Laden mit Büchern hat, in den immer wieder verschiedene Leute zu Besuch kommen: Lea, eine Freundin, Rio, ein junger Mann, mit dem sich eine Liebesgeschichte andeutet, die aber vielleicht auch in der Vergangenheit liegt, und Herr Emm, ein alter Herr, der auf der Straße auf und ab geht. Dann gibt es noch eine Ich-Erzählerin, die sich Sorgen um Hanna macht, sie umkreisend beobachtet und Hannas Zustand verstehen möchte. Denn Hanna, so erfährt man, ist in letzter Zeit „merkwürdig“, sie verlässt das Haus nicht, spricht kaum, liest, schaut aus dem Fenster und rollt immer wieder ihre Finger ein – eine Geste des Verschließens. Das war früher anders, da war Hanna lebenstüchtig, praktisch, initiativ und hatte „einen untrüglichen Sinn für den richtigen Zeitpunkt, die richtige Handlung, das richtige Ding“. Das Ich kennt den Grund für diese Verwandlung nicht: „Ich fasse nicht, was sich zwischen uns verändert hat, und nicht, weshalb Hanna jegliches Vertrauen in den kleinen Ort unter dem Dachfenster verloren hat.“ So wird der Roman zu einer Suche nach einem verlorenen Zustand, zu einer Spurensuche nach einer Person, die beschlossen hat zu verschwinden.
Nicht, dass es keine Geschichte gäbe, man hat das Gefühl, es ist ganz viel, mitunter sogar Ungeheuerliches zwischen diesen Figuren passiert, aber erzählt wird in der Leerstelle. Es scheint Winkler um die größtmögliche erzählerische Unschärfe zu gehen. Wie ist erzählen dennoch möglich, wenn nicht mehr erzählt werden kann? Diese Unschärfe wird sehr gekonnt auf mehreren Ebenen hergestellt: Sprachlich durch die sofortige Zurücknahme jeder Andeutung in einem Konjunktiv, einem Widerspruch oder einer neuerlichen Frage. Aber auch die Orte, die Zeit, die Figuren und deren Handlungen werden zu unberechenbaren Größen. Mal kippt das Jetzt in eine übermächtige Vergangenheit, wird ein Gefühl plötzlich zu einem Ding, ein Innenraum zu einem Außenraum. Die alten Einheiten werden aufgelöst und das Verb „handeln“ wird mit einem Fragezeichen bedacht: Es ist ein „altes unmögliches Wort“. Diese Unentschiedenheit führt ins Ungefähre, ins Verschwinden, was ja auch der Problematik der Protagonistin entspricht.
Doch vielleicht spielt sich Hannas Geschichte nur im Kopf der Hauptfigur ab. Die Orte bleiben seltsam abstrakt, wie Bühnenbildversatzstücke in einem Theaterstück, in dem es in Beckettmanier einen Baum gibt, eine Bank und ansonsten nur das Warten. Die Figuren erscheinen wie durch eine Glasscheibe, wie in einem Film ohne Ton. Erzählt werden gleich Eintragungen in einem Regiebuch nur die Bewegungen und die Gesten der Figuren. Theater spielt überhaupt eine große Rolle als Erfindungsprinzip, als Möglichkeitsraum, in dem alles so ist als ob, aber eben nicht Wirklichkeit: „Ich sitze in einem Publikumsraum und schaue auf die Bühne, aber ich weiß nicht, ob da vorne nicht ich gespielt werde, ob man da vorne nicht mich in Szene setzt, mich und dich auch.“ Die Figuren proben fortlaufend ihre Erinnerung, die Vergangenheit wird nachgestellt: So könnte es gewesen sein, aber natürlich auch anders… Es könnte sich bei Hannas Geschichte nämlich auch um eine flüchtige Erinnerung auf einer Zugfahrt handeln, während der die Spiegelungen im Fenster das Bild einer Vergangenheit zurückwerfen und wie in Ilse Aichingers Spiegelgeschichte, bloß komplexer, ein Leben rückwärts im Zeitraffer entworfen wird. Oder sind Lea, Herr Emm und das Ich nur imaginäre Begleiter von Hanna, die eine über der Erinnerung brütende Autorin aufsuchen und mit ihren Geschichten bedrängen, wie die sechs Personen ihren Autor in Pirandellos Bühnenstück? Winklers labyrinthische Sprachräume bieten jede Menge Rätsel für den Leser, der seine eigenen Geschichten entwerfen kann.
Das alles könnte wahnsinnig verwirrend und anstrengend sein, wenn es nicht die Autorin verstünde, gekonnt einen sprachlichen Sog aufzubauen. „So kompromisslos hat sich lange schon niemand mehr aufs Glatteis der Sprache gewagt“, wurde ihr Debüt von der Kritik gelobt. Winkler gelingt mit Hanna und ich wieder ein beachtliches sprachliches Experiment. Sie schafft es in diesem Entwicklungsroman eines Stillstandes formal anspruchsvoll und experimentell zu sein und trotzdem zu erzählen. Das Geschäft des Autors ist es, die Grenzen des Sagbaren in Richtung Unsagbares auszudehnen und so im Sinne Wittgensteins, der auch zitiert wird, die Grenzen unserer Welt zu erweitern. Winkler gibt einer heutigen Entfremdungserfahrung, der Beliebigkeit und Geschichtslosigkeit in modernen, kafkaesken Arbeitszusammenhängen und zwischenmenschlichen Beziehungen eine Stimme. Sie führt an Hannas Verweigerung vor, was uns allen geschieht, und gibt einem Grundunbehagen an einer flexiblen, austauschbaren Welt, in der wir alle leben „so als ob“, einen literarischen Raum.