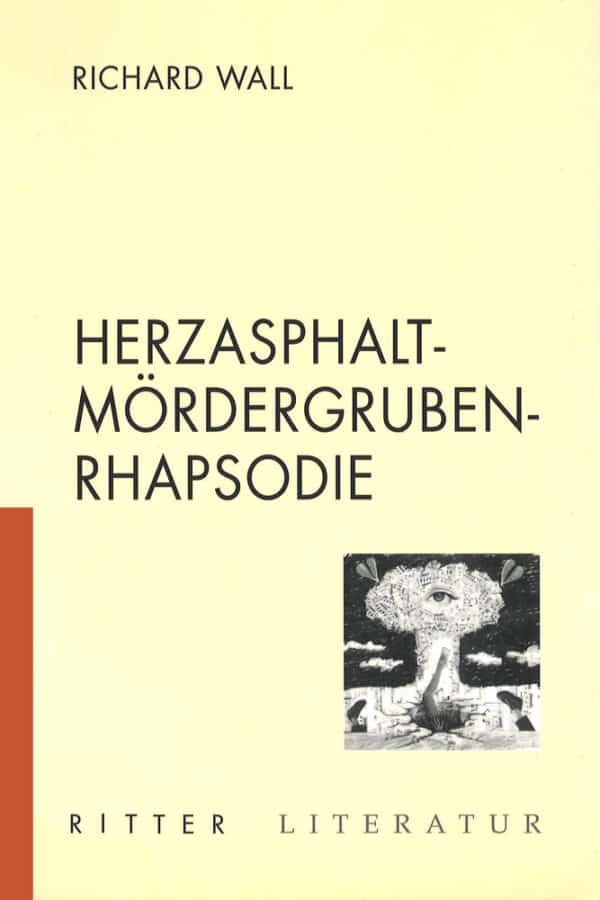Anfänglich finden sich Konsumwahn und Egoismus auf dem Prüfstand, und das Bild kopulierender Tiere illustriert zugleich jenes zusammenstoßender Autos auf Autobahnen. Beim fortschreitenden Sinnieren weitet sich der Kreis auf alle medien- und ideologiemanipulierten, am „Täglich Alles-Schnuller“ (S. 28) nuckelnden Vertreter einer infantilisierten Bevölkerung. Die Katastrophen, die eine derart deformierte Gesellschaft produziert, sind bekannt: Von der „Wildnis im Herzen“ wird der Bogen über Atombombe und Golfkrieg zu den „Mördergruben“ in Ruanda (S. 17f.) gespannt.
Der Autor läßt seiner Erregung über die verkehrte Welt in experimentierfreudiger, von Wortneuschöpfungen und mündlichen Anklängen („Schpombanadln“, „gneißt“) belebter Sprache freien Lauf. In oft überraschenden Bildern und metaphorischen Überlagerungen eröffnet sich so der Blick auf den Zusammenhang von Gebrauch und Mißbrauch der Sprache im Dienste der politischen Macht. Gleichwohl will sich Walls Zorn über die angeprangerten Mißstände nicht zu einem lustvollen Furioso auswachsen, sondern plätschert in einem an Thomas Bernhard erinnernden Lamento dahin: Zu schal bleibt der Geschmack der bereits oft wiederholten Metaphern und banalen Beobachtungen, zu nahe am Klischee erstarren die häufig gedoppelten Bild- und Klangassoziationen.
Nicht von ungefähr trägt Richard Walls Text die Eigendefinition bereits im Titel: „Rhapsodie“ meint das bruchstückhafte Assoziieren über ein Thema. Der Zerfall der Welt wird im fragmentarischen Erzählen gespiegelt. Schlußendlich gibt es für den Autor keine Alternativen zum beklagten Zustand, und auch sein Wort wird nichts daran ändern. So bleibt ihm nichts anderes, als zu resignieren, denn – mit einem Ausspruch Laotses – für Wall liegt das Glück in der allein auf sich gerichteten Selbstbezogenheit: „Nur wer wie das Wasser streitet mit keinem, ist ohne Leid.“ (S. 93)