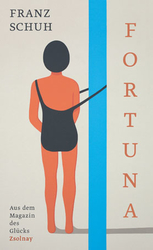Wenig zufällig lautet der erste Satz in seiner vorliegenden Sammlung: „In meinem Körper/bin ich die Nummer 1.“ Ganz dem wie nebenbei direkt erwähnten, doch in seinen Verhandlungen über das Glück m.E. nach stets präsenten Michel de Montaigne verpflichtet, macht sich der Philosoph und Essayist im allerbesten Sinne selbst zum Dreh- und Angelpunkt des Buchs.
In seinem (und eben nicht einfach: einem) Magazin des Glücks – dem wenig zufällig quer durch die Literaturgeschichte freundlicher Entlehnungen wandernden Titel – erweist er sich, unterhaltend und ernsthaft zugleich durch ein Territorium spazierend, als Meister der Verknüpfung. Schuh navigiert mühelos von Kant, Schopenhauer und Adorno zu Criminal Minds, Breaking Bad oder Stöckl, von Kraus, Brecht und Aichinger zu Götz George, Horst Buchholz und dem Leben im Gemeindebau. In seiner „Umkehrung des Schreckens“ macht er deutlich, was alles unter dem Begriff des Glücks firmiert, darunter zusammenkommen kann.
Schuh vermeidet in seiner Anlistung des Erfreulichen und Fordernden aber die Fallstricke des Ratgeberischen; vielmehr fragt er, wenn er beispielsweise Liebe, Körper-haben-und-sein, Zufall oder Virtuosität verhandelnd aufruft, nach den Bedingungen, unter denen man wie was über das Glück und seine ganz eigenen Konditionen bzw. die dazugehörigen Strategien der Inklusion und Exklusion wissen kann. Unter der Perspektive von Finalität, dem Tod als „Zusammenfassung aller Grenzen, die dem endlichen Menschen gesetzt sind“, ergreift er wieder und wieder das Wort.
Womit wird also philosophisch und literarisch operiert, um Entwürfe und Vorstellungen des Glücks oder eben auch des (mitunter: unerreichbaren) Glücklichseins überhaupt gestalten zu können? Augenblick und Dauer werden prüfend gegeneinandergehalten, „Hoffnung“ ist dabei mehr als bloß eine ansprechende Überschrift. Wenig zufällig stolpert man lesend über den Satz: „Dass das Leben schön sei, ist eine quälende Behauptung.“ An Stellen wie dieser zeigt sich m.E. nach besonders deutlich, wie Schuh angesichts der Zumutungen des Lebens Glück denkerisch einkreist, ohne es endgültig fassen, ohne es zu Ende erklären zu wollen. Es sind Motti wie diese, die ein Ausverhandeln von Einsichten und Ermutigungen deutlich machen, das nicht nur analysieren, sondern auch ermutigen möchte.
Man muss also ein Trickster sein, um mit der „List“, der erfreulicherweise (zumindest in aller Offensichtlichkeit) ein eigener Text gewidmet ist, als „geschichtsphilosophische(r) Kategorie „dem allgemeinen Lauf der Dinge in finsteren Zeiten“ etwas entgegenzusetzen, ja, überhaupt etwas entgegensetzen zu können. Schuhs strategische Instrumente der literarischen List – auch zur Vermeidung des zu befragenden, fragwürdigen Umstands, Glück immer an Unglück gekoppelt zu sehen – sind, so meine Leseweise, Resilienz und Kontingenz:
In der Resilienz finden wir das Moment der Balance, die Haltung der (Selbst-)Ermittlung, die Prinzipien von widerständiger Aufmerksamkeit und ausweichender Ablenkung.
Die Kontingenz wiederum stellt das Mögliche und Potenzielle in ein Verhältnis zum Schicksalshaften – Fortuna wird also auch in ihrer kurvigen Kehrseite sichtbar. In der Überwindung einer vorgegebenen Ordnung, im Bruch mit dem Verordneten lässt sich ein zeitlicher Horizont aufspannen, also eben auch der schlüpfrige Term der Lebensspanne reflektieren. Die daran geknüpften gesellschaftlichen Erfahrungen des Einzelnen räumen in letzter Konsequenz auch etwas wie Geschichtsmächtigkeit ein, die abseits aller Notwendigkeiten etwas wie Optionen des Anders-Sein-Könnens und Nicht-Sein-Könnens spürbar macht. Dass all das aber nicht gleich (also auch im Sinne von: egal) ist, adressiert Schuh auf anthropologische Weise: Kontingenz wird so zum Ausdruck einer literarisch beschriebenen Unverfügbarkeit über bestimmte menschliche Kernerfahrungen – also eben Sterblichkeit, Liebe, Glück. Wenn Kontingenz somit auch das Unbeabsichtigte, das Regel- und Ursachenlose ist, das sich der Steuerung und Prognose (zumeist) entzieht, wundert es nicht so sehr, dass sie immer wieder aus dem Bereich abgesicherter Wissensdiskurse argumentativ herausgelöst oder mit den Mitteln von Vernunft und Norm vermeintlich gezähmt wird. Großmeister Hegel zum Trotz darf davon ausgegangen werden, dass Veränderlichkeit, Endlichkeit und Zufälligkeit abseits der Schlachtbank des Geschichtlichen (bzw. der historiographisch verfertigten Geschichte) Teile menschlichen Erlebens und auch Handelns sind. Nicht zuletzt sind es künstlerische und oftmals narrativ fundierte Verfahren, die Kontingenz beschreibbar machen, sie erzählerisch reflektieren.
Das Ringen um die eigene Erfahrung und Biografie, um die Gegenwart als Fluchtlinie der eigenen Figur manifestiert sich mit Schuh (im Anschluss an den hierzulande viel zu selten gelesenen Michel Serres) als notwendige Korrektur der konstant geschöpften philosophischen Menschenbilder, die in ihrer holistischen Prinzipienhaftigkeit schwerer zu wiegen scheinen als in ihrer fragmentierten Tatsächlichkeit: „Nichts ist ungeheurer als der Mensch.“ Ein glückliches Magazin ist somit eines, das sich noch nicht erschöpft hat.