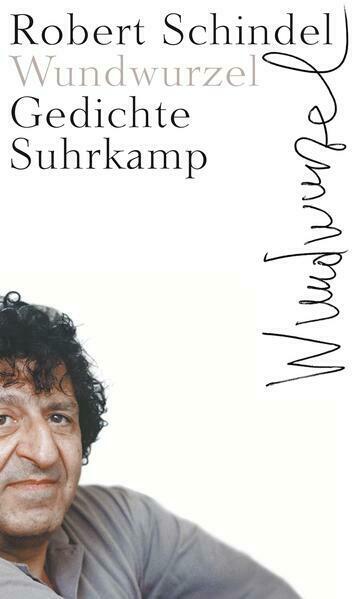„Nur fortgeschritten, fort und fort“ hetzt es im ersten Gedichtzyklus des Lyrikbandes atemlos durch das „Pilzgestöber“ der Zeit. Der Befund: bewusstloser Fortschritt ohne Fortschreiten, rotierende Gegenwart statt Zukunft. „Was für ein Stecken / Im Gegenwärtigen.“ Und die Kälte hat zugenommen. Frostig sind sie geworden, die heutigen „Harschwelten“. Winterlandschaften, Raunächte und „Schneegehunds“ bestimmen das politische wie das private Panorama: „Alles wird weißern“. Vom Nachtfrost, Absterben und Einweißen sprechen die Verse. Wohlgeformt und oft schön gereimt wie diese: „Wohin ich schau, und was ich weiß / Verweht ist es und nicht mehr dort / Sodass, was werden sollt, auch nicht geschah / (…) Und eiserstarrt bin ich und auf der Stell.“ Die Welt, das Ich und selbst die Sprache ist „runtergehundet“. Was bleibt von der rettenden Dichtung? „Worthaufen“, „Wortkot“ und „Wortabdeckerei“. Auch sie wird „weißern“: „Was wir auch je ersehnten / Kaltet im Buchstaben. Starrt.“
Wo also ist der Ausweg? Wo die Rettung vor der immer schneller ablaufenden Zeit, fort und fort? „Worauf / Gründet sich eine Sinnstiftung“? Am Ende sieht sich das Ich der Gedichte zurückgeworfen auf seinen Ursprung, die Wundwurzel. „So liegt die Wurzel wund“, konstatiert es im zweiten Gedichtzyklus des Bandes wehmütig, ohnmächtig und wütend. Hilflos gegenüber der machtvollen Präsenz der Toten, ihrer verblichenen Namen und dem lautstarken Echo der tödlichen Schüsse im Rigaer Rumbulawald zwängt es sein barockes memento mori in kunstvoll gereimte, aber rhythmisch brüchige Sonette. Die „Juden unterm immergrünen Hügel / Die sind in ihrem Totsein zugegeben unflexibel / Sodass ich selten Künftiges erhasch“ beklagt sich das Ich der Gedichte zynisch und auch ein wenig bitter. Es leidet unter den Alpträumen der Frühvergangenheit und schwitzt im „Traumsturm“ „eingeleibte Spätzukünfte“ aus. Auswurzeln möchte es sich manchmal, kann aber seiner Herkunft nicht ausweichen und wird von der Vergangenheit in Bann gehalten. Kaum überlebensfähig in der Gegenwart und ohne Zukunft „liegt die Wurzel wund (…) Und geht zugrund.“ Und dennoch klingen die letzten Verse des Zyklus versöhnlich: „Die Stunden / Rinnen vergnügt Vergangnem zu / Sodass die Künftigkeiten rein und klar.“
Wo liegt die Ursache der unvermutenden Versöhnung? In der Liebe? Immerhin: Im „Lustblickerbarmen“ findet das lyrische Ich für Augenblicke Rettung. Umschlungen, beieinander, schlafenswach und „Ganz ineinand wie nie“, so der Titel des dritten Gedichtzyklus. Berauscht im Liebesrondo und den Begierdepsalm betend, stimmt der Liebende mit sich und der Welt überein. Zumindest zeitweise. Bis er in den „Liebesschnitz“ fällt. Denn verliebtes „Wortgeflunker“ und Sinneslust halten nur für Augenblicke: „beim Höhern-Sinne-Raster / Bleibt der Fortschritt, was er war“. Liebes- und lebensgierig, voller Sinnlichkeit und Begehren sind die Verse. Drastisch, grotesk und voller „Leibschrundigkeiten“ die Sprache. Denn hinter der Lust steckt der Tod, und ein „Körper wurzelt sich im Knirsch / Vor er endgültig bestattet“.
Vielleicht gibt es, ein poetischer Widerruf des Adornoschen Verdikts, doch ein richtiges Leben im falschen? Nämlich als Dichter? Vielleicht findet sich die Antwort im „Im Zungengrund“ der Worte? Der Titel des dritten Gedichtzyklus „Silben aufeinander und ungenug“ macht allerdings wenig Hoffnung. Auch wenn der Dichter Tag um Tag die Wortreuse in die Weite hinauswirft: Sein Fang bleibt mager. „Die Dichter strecken in ihre Zeit. / Diese beklimpert die müden Wörterleiber“. Zwischen oberflächlichen Tratschsuiten, Geschnatter und Intensivgebrüll verläuft sich das Maulaufreißen in unbeantwortete Fragen. Und im Inneren des Wortes? „Buchstaben im Blut / Silben aufeinander und ungenug / Bastarde allen Ortes“. Mit derben Tiraden hetzt das lyrische Ich gegen die „Wortscheißerei“ der Vielschreiber. Es beklagt in wehleidigem sprachkritischem Lamento die „Nullsucht“ der Dichtung. Und zeichnet ironisch ein jämmerliches und groteskes Bild der selbstverliebten Poeten. Aber am Ende steht, wie oft bei Schindel, ein Dennoch. Die trotzige Behauptung der Macht der Poesie gegenüber dem Zeitgeist: Denn das „Lied aus uralten Zeiten / Hat Zukunft aus gutem Grund / Es häutet die künftigen Weiten / Zertrümmert den Gegenwartsmund“.
In Versöhnung und Zustimmung mündet der Gedichtband im letzten Zyklus „Das fernesferne Mittendrin“. Plötzlich stimmt der Herzschritt. Unter der Decke und unter der Zunge findet das lyrische Ich sich eins mit sich selbst. Im poetischen Sommer summt es sein Sehnliedchen, seine „Sinnessuite“. Wunderbar und „wunderruhig“ ist es geworden. „Ich gehe durch meinen innernen Ort“. Das ewige Ungenug ist einem wohligen Behagen gewichen. Auch die Verse finden ihr Gleichmaß in ebenmäßig geformten und rhythmisch wiegenden Zeilen. Einverstanden mit der Vergangenheit und mit seinem Inneren und Äußeren vereint, findet das Ich der Gedichte Ruhe und Harmonie. Allerdings im wachen Bewusstsein, dass die fragilen Glücksmomente nur von begrenzter Dauer sein können. Lediglich ein „Sekundenerbarmen“ wird ihm gegönnt unter „nicht gern sinkenden Himmeln“.
In Schindels Wundwurzel „Donnert es vom Ich“. Wie in früheren Gedichtbänden ist er, „Fremd bei mir selbst“ und „Ohneland“, auf der wütenden Suche nach Identität und Heimat. Aber die poetische Auseinandersetzung mit Vergangenheit, Sprache, Liebe und Vergänglichkeit scheint noch schärfer geworden. „Vorm Absterben“ wird die „Wortsucht“ gieriger und verschafft sich in kühnen Neologismen und drastischen Wortkonglomeraten lautstark Gehör. Verse und Rhythmen stolpern brüchiger, kontrastreich in klassische Versformen und Reime gefasst. Krass dringt die Vergänglichkeit mit dem alternden Körper in die Sprache. Heimat und Identität sind jetzt, mehr denn je, Utopie: Finden wird er sie „Immernie“. Statt dessen steht er sich nach wie vor als „Sprechblasensubstrat Streifenmensch“ im lebenslangen Bemühen gegenüber, „unabhängig voneinander zu funktionieren“. Manchmal mag es ihm dennoch gelingen, mit „Poesiewortgepolter“ die Ängste in die „Dose des Wortes“ zu sperren, wo sie „vielleicht noch ein bisschen herumsummen, aber nicht mehr ausgelassen werden können.“ Dafür müssen aber zahllose Parallel-Identitäten in Schach gehalten werden: Kommunikationskerle, Sexmandl, Politaffen, Privatraunzer oder Extradurchschauer. All diese rauhen und zugleich sensiblen Zeitgenossen – diese im Äußersten verwalteten „Innerstenburschel“ und im Inneren eingeschreinten „Äußerstenburschel“ -, die die Wundwurzel-Gedichte bevölkern. Sie schinderln mit ihrem „Fiakergulasch“ sprachgewaltig durch die Verse, wo sie stotternd und stolpernd zur Sprache gelangen. Sie schleudern ihre „Wortmonster“ in die Zeilen, dass es hallt. Paradox und vielstimmig, von grober Sanftheit und zarter Grobheit ist die Sprache dieser Schindelschen Kerle, die sich schwer in die „Dose des Wortes“ sperren lassen. Melancholisch ironische Wortakrobaten, die sich, mit ihrer unbändigen sinnlichen Lust am Leben vielleicht am Schluss doch noch an der Wundwurzel packen und über geglückte „Herkünfte“ ins Künftige biegen.