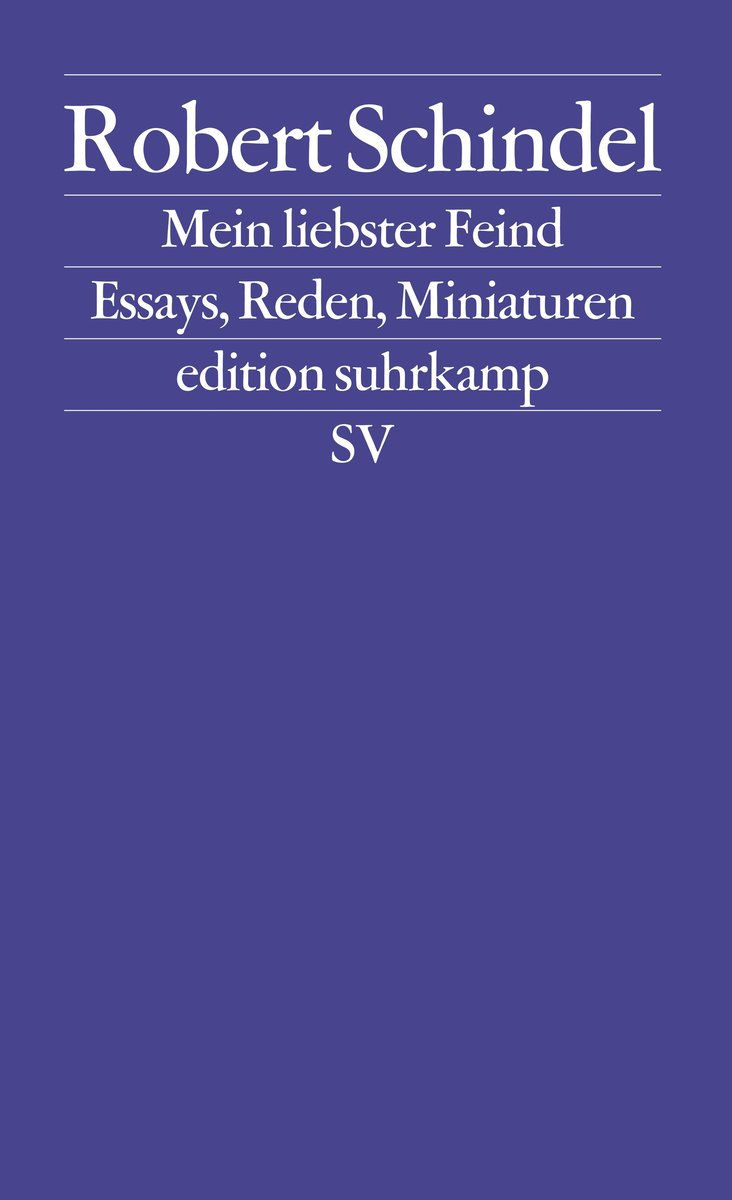Betrachtet man die Biografie Robert Schindels, so ergeben sich Themen dieser Art beinahe von selbst, ist er doch als „das dunkelhaarige Franzosenkind, der unerkannte Judenbalg“ ausgerechnet im Luftschutzkeller der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt aufgewachsen, während seine Eltern im KZ um ihr Überleben kämpften, „vom Tod bedroht und teils vom Tod ereilt.“
Er selbst hatte Glück im Unglück, die autrichiens (bzw. „autre chiens“) hatten ihn mit ihrer Hetz verschont. Und er sieht sich heute einem wiederentfachten Antisemitismus ausgesetzt, der Hand in Hand geht damit, dass „der Jörgl den Spaß in die Politik zurückbringt, die Hetz …“ Und auf der anderen Seite gibt es die Kritik anderer Juden, die Kritik von Israelis, die bemängeln, dass er trotz allem gerne in Wien im Kaffeehaus sitzt und Zeitung liest, und sei Letzteres auch ein noch so zweifelhaftes Vergnügen. Aber wie es auch zugehen mag in der Welt, der „liebste Feind“ ist doch immer das eigene Ich.
Schindel zeigt Juden als Kosmopoliten aus Notwendigkeit, „ein Volk der Hinausgeschmissenen“, das sich überall heimisch fühlen muss, weil man es nirgendwo heimisch werden lässt. Und die Wiener Kaffeehäuser sind zumindest sicherer als jene in Jerusalem.
Was bleibt also anderes als Flucht in die Sprache, Zuflucht bei der Literatur, bei der eigenen und bei der anderer. Paul Celan, Robert Menasse und Ernst Jandl werden gewürdigt, aber auch der eine oder andere Politker hat Eingang gefunden in die Essays, so etwa Ernst Fischer oder Franz Marek, vergangene Größen aus besseren Zeiten der KPÖ.
Auch das nicht unproblematisch: Judentum und Kommunismus, es wird Rechtfertigung verlangt für die Politik im Staate Israel und für die Fehler kommunistischer Agitatoren. Die Ideologie, in der man sich tatsächlich zu Hause fühlen könnte, die muss wohl erst erfunden werden. Und das Volk, zu dem man sich wirklich zugehörig fühlen könnte, ist nur ein Hirngespinst?
Das Volk ist, wem man aufs Maul schauen kann, an der Sirk-Ecke oder am Korso. Der Versuch, einen „doppelten Blick“ auf Deutschland zu werfen, auf „Deutschland, von außen gesehen“ führt dann doch wieder nach Wien und zu Karl Kraus. „Die letzten Tage der Menschheit“ werden ausgiebig zitiert, weniger mit literarischem als mit historisch-politischem Bezug. Dabei hütet sich Robert Schindel bei aller Schonungslosigkeit davor, sich in Pauschalurteilen zu verlieren.
Auch ist nicht alles schlecht im Land. Einer der schönsten Texte des Bändchens setzt sich mit der Literaturzeitschrift „Wespennest“ auseinander, mit ihrer Gründung, fruchtbaren Konflikten in der Redaktion und dreißig Jahren Überleben im Literaturbetrieb, allein das schon eine Leistung: „Wieso geht das Wespennest nicht ein? Alle Voraussetzungen zum Eingehen waren gegeben. Geld hatten sie keins, gestritten haben sie wie die Teufel.“ Aber in einer Literaturzeitschrift, die ihren Namen verdient, muss man streiten, erfahren wir, ohne Richtungsdiskussionen keine Linie, keine Qualität. Und siehe da, das Wespennest hat es geschafft, hat sich etabliert. Dann kam die jüngere „Kolik“, ein völlig anderes Konzept und damit die Frage, „was Literaturzeitschriften in der heutigen Zeit sollen.“
Abgesehen davon, dass es schön ist, dass es sie gibt, und es noch schöner ist, wenn neue entstehen: „Daher ein Hoch allen Literaturzeitschriften und eine Empfehlung für die Jungen: wenn euch diese fetten Ärsche, diese Schindels, Ernsts, Menasses, Henisch und wie sie heißen, nicht hochkommen lassen, dann gründet doch eine Literaturzeitschrift, damit dort drinsteht, was ihr schreibt. Rechnet halt ab mit den Etablierten, streitet wie die Teufel, schmeißt euch gegenseitig aber hintereinander raus, und wuchtet euch durch!“
Danke, Herr Schindel, wenn es soweit ist, dann schicken wir Ihnen ein Ehrenexemplar.