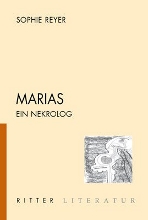Bis ins 18. Jahrhundert und weiter reichen Reyers Fallgeschichten zurück. „schone mich, das klingt nun schon nach schablone“, heißt es, und tatsächlich ähneln sich die Stationen dieser Taten auf beklemmende Weise: unehelicher Geschlechtsverkehr, der Versuch, zuerst die Schwangerschaft, dann die Geburt, dann den ermordeten Säugling zu verbergen; schließlich Überführung, Geständnis und Zuchthaus (oder Schlimmeres). „schon wieder so eine maria“ lautet die Formel, nach der diese grausige Gleichförmigkeit abgehandelt wird.
Reyer zeichnet ihre Protagonistinnen dabei als Figuren gesellschaftlicher Zurichtung (deren Gesichter und Hände immer mehr den Äckern gleichen, auf denen sie arbeiten); gleichzeitig versucht sie, ihnen eine Stimme zu leihen, besser: einen literarischen Aufschrei, der gegliedert wird durch Anlehnung an die musikalische Form des Requiems. Dabei bedient sich die Autorin zahlreicher Zungen: der Beobachtungen und Mutmaßungen des Umfelds, protokollierter Zeugenaussagen, der Perspektive eines ungreifbaren, verurteilenden Kollektivs.
Dazu kommen die Reflexionen einer im Hier und Jetzt lebenden weiblichen Stimme, die über den Akten immer wütender zu werden scheint. Sie ist es, die diese historischen Schicksale aufzählt, nicht ohne Drastik: „brav weiter soldaten aus der scheide scheißen“ ist keineswegs die deftigste Beschreibung eines Geburtsvorganges. Hinzu kommt aber auch eine gewisse Abgeklärtheit (die für die besten Stellen des Buches sorgt): „wer weint ist zwar schon einen schritt weiter als die die glauben mit der sprache gegen etwas anschreien zu können/aber auch das lacrymosa verhilft uns nicht zu einer geschichte, liebe maria“
Dazu geizt diese Stimme nicht mit historischen Details: Man erfährt (vielleicht nicht zum ersten Mal) von der gesellschaftlichen Ächtung lediger Mütter, dem überraschend hohen Prozentsatz unverheirateter Erwachsener, dem zweifelhaften Ruf der Findel- und Gebärhäuser, der erwartbar haarsträubenden Gesetzeslage der Zeit und den makabren gerichtsmedizinischen Methoden.
Was über diese wenigen Daten und die Funde in den Akten hinausgeht, imaginiert Reyer in eindringlichen Motivketten, beißenden, manchmal kalauernden Wortspielen, sermonartig wiederkehrenden Formulierungen.
Damit nimmt sie ein genuin literarisches Vorrecht in Anspruch: einen Diskurs (hier den historischen) aufzunehmen, ohne ihn zur Gänze gelten lassen zu müssen; dort zu imaginieren, wo die Geschichtsschreibung bloß auf ihren Informationsnotstand hinweisen kann. Ob das aber auch die folgende Passage mit einschließt (und einige andere), ist fraglich: „die annahme dass der mord in deinem hormonhaushalt als keim angelegt sei/[wird] weitere forschungen legitimieren/die leiber der weiber werden also wie blütenkelche geöffnet werden/und welche frau dabei in der narkose auch noch vergewaltigt wurde/wer schreibt schon darüber.“
Wird hier nicht, ganz abseits der literarischen Freiheiten im Umgang mit historischem Material, die immer noch größere Grauslichkeit in die Lücken eben dieses Materials hineingelesen, ja: hineinreklamiert? Das könnte ein Missverständnis sein; allerdings findet sich in dieser wie anderen Passagen dieser Sorte kein Anhaltspunkt, der den Text in (z. B. ironische) Distanz rücken würde. Das ist schade, weil (und sollte vielleicht nicht davon ablenken, dass) Reyers Sprecherin ansonsten die Leerstellen der Vergangenheit geschickt aufzeigt und als eben solche belässt.
Zudem kreidet Reyer (zweifellos zu Recht) an, dass der Kindsmord im historischen Fokus notorisch hinter soziologischen u. ä. Befunden verschwindet, während er in der Presse tendenziell auf die psychologische Ausnahmesituation – die Täterin als Monster oder als Opfer – reduziert wird. Was allerdings bedeutet das, wenn beispielsweise die Rede ist von der „gesellschaftskritik die in der wut dieses aktes liegt“? Wessen gesellschaftskritisches Statement ist denn so eine Tat? Das der Täterinnen wohl kaum; ihnen eine Agenda zu unterstellen, ist zumindest irritierend.
Hinzu kommt die Überlegung, ob die Autorin nicht an mancher Stelle den Anschluss an den aktuellen Reflexionsstand preisgibt; oder ob die „Marias“ hier nicht ein weiteres Mal „zugerichtet“ werden.
Will man Reyers Text gerecht werden, sollte man solche Überlegungen vielleicht dem (mitunter beeindruckenden) literarischen Furor opfern. Stellt sich die Frage, ob dieses Opfer nicht zu groß ist.