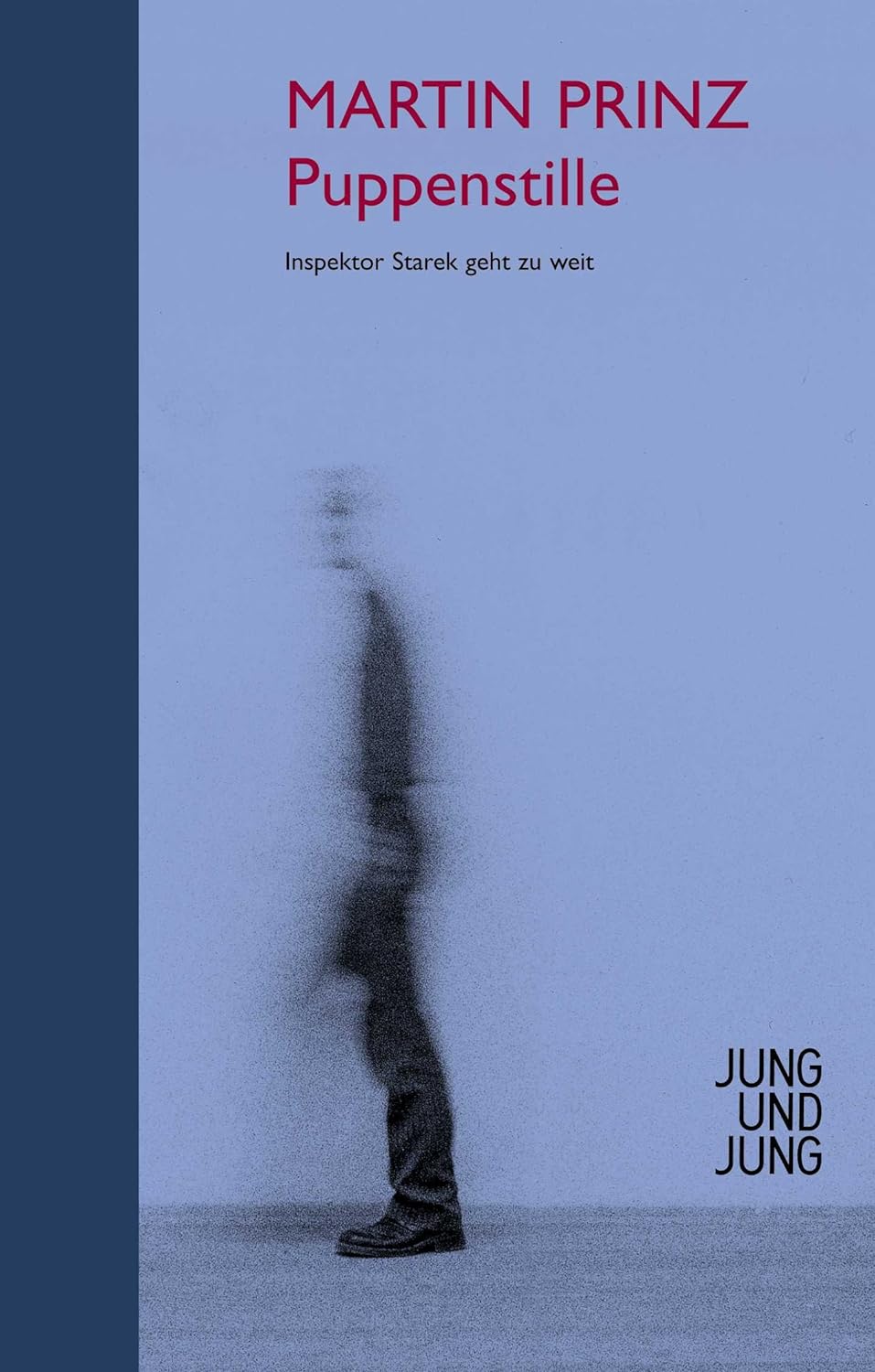So hat der Autor sich gegen die Enttäuschung routinierter Krimi-Leser gewappnet, zugleich jedoch die Ansprüche ins Literarische hinaufgeschraubt. Wenn es nicht um die Ausforschung eines Mörders geht, ja nicht einmal wirklich um die Lösung eines Falles, dann muß es um etwas anderes gehen. Zunächst einmal interessiert Martin Prinz sich für seinen Helden, und das ist immerhin etwas. Starek, der einstige Inspektor, hat es in den gehobenen Kriminaldienst geschafft, wo er sich nicht einfach nur fadisiert, sondern im bürokratischen Routinelauf allzu sehr auf seine existentiellen Nöte zurückgeworfen sieht. So leidet er denn, fatal für einen Krimineser, unter „Antriebslosigkeit“, in der Früh sowieso und nach dem Mittagessen und dem Genuß einiger Gläser Bier erst recht – ein Anti-Maigret sozusagen, läßt sich der Pariser Kollege doch stets von dem einen oder anderen Aperitif mit Kollegen im Bistro inspirieren.
Starek vermißt das „Inspektorgefühl“, den Rausch des Ermittelns, der jenem des Lesens in jungen Jahren gleichkommt, mit dem er sich einen Schutzwall gegen Alptraum-Ängste aufgebaut hat. Also verläßt er den öden Gruppenleiter-Schreibtisch und stürzt sich in die Straßen Wiens, ein alter Jagdhund auf neuer Fahrt und frischer Fährte. In der Beschreibung des Polizisten als Flaneur, als Beobachter, als eine Membran städtischen Lebens ist der Autor ganz in seinem Element: Das Lokalkolorit und Stareks immer wieder abdriftende Bewußtseinszustände machen Prinz sichtlich mehr Vergnügen als das Knüpfen kriminalistischer Fäden. (Beim Fallrätsel wiederum könnte man sich an den schwedischen Krimikönner Ake Edwardson erinnert fühlen, einen Spezialisten für Abseitiges.)
Auch Autor Prinz geht in manchem zu weit: Da kollidieren Informationen über Reales – etwa die bevorstehende Auflösung des traditionsreichen Wiener Sicherheitsbüros – mit unnötigen Unschärfen („Ein, zwei Stunden später war Starek schließlich zu Hause“) und deplacierten Poetisierungen wie: „Mehr Licht kam erst im Winter durch, wenn die Bäume als dunkle Skelette in den Himmel ragten.“ Dem prägnanten Minimalismus eines Georges Simenon, der mit ein, zwei beiläufigen Sätzen Atmosphäre und Charaktere skizziert und dabei stets am Ball – nämlich dem des Krimiplots – bleibt, steht Prinz offenkundig fern.
Einiges in diesem Text (Konjunktivfehler, uneinheitliche Rechtschreibung) ist einfach schlampig lektoriert. Mitunter aber kommt der Erzähler in diesem Buch so hölzern daher, daß man bei einem sprachbewußten Autor wie Martin Prinz nur Absicht vermuten kann: Weil Starek einer ist, der, ähnlich wie der Detektiv Brenner des Wolf Haas, gerade beim Abschweifen zu genauerem Denken findet, soll die Umständlichkeit sich vielleicht als Stilprinzip abbilden. Wäre dem so, dann mangelte es allerdings an Konsequenz. Denn es finden sich in Puppenstille auch etliche geglückte Sätze wie jener, der einen Herbsttag beschreibt: „Mit so auffälliger Zufriedenheit saßen die Leute (…) in der Sonne, als bekämen sie dafür bezahlt.“
Daß der Sprache jene Selbstverständlichkeit abgeht, die Prinz‘ erstes Buch ausgezeichnet hat, verrät wohl eine ungesunde Distanz zur eigenen Geschichte. Pornographie, Internetgeschäft, Voyeurismus, Autoerotik und nekrophile Sexualpraktiken sind alles Themen, deren aktuelle Bedeutung man in den Chronikteilen der Zeitungen nachlesen kann. Hier scheint es, als würde ein Autor sie pflichtschuldigst abhandeln, den sie nicht wirklich interessieren. Letztlich läuft in Puppenstille alles auf einen tödlich radikalen feministischen Aktionismus hinaus. Wenn Prinz uns, ohne den Namen zu nennen, die hier fruchtbar werdende Gedankenwelt der Performancekünstlerin Elke Krystufek nahebringt, wirkt der programmatisch erniedrigte und dadurch ästhetisch erhöhte Frauenkörper im Text wie ein Fremdkörper.
So kommt diese Kriminalerzählung über den Charakter einer Fingerübung nicht hinaus: Prinz zeigt uns, daß er die Puppen tanzen lassen kann, ohne die Fäden zu verwirren. Aber auch nicht mehr.