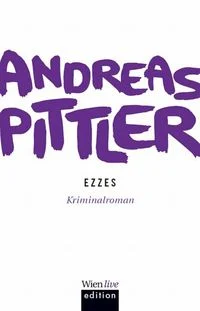Notorisch triebgesteuert drangsalierte der gewalttätige Geizkragen ferner die jungen Angestellten seiner mittels Zinsertrag erworbenen Greißlerei. Auch deren Nachfolgerinnen, eine ambitionierte Studentin und eine Schneiderin, sehen sich sexueller Belästigung ausgesetzt. Nachdem Bronstein finanzielle, geschäftliche und Rachemotive ausscheiden kann, bleibt nur ein sexuelles, war doch der Tote kurz vor seinem Samenerguss gestanden. Hier aber interferiert die Politik. Bronsteins Vorgesetzter ist der vormalige (auch spätere) Bundeskanzler und nunmehrige Polizeipräsident Johann Schober, ein zwischen deutschnational und christlichsozial changierender Opportunist und antisemitischer Sozialistenhasser. Schober versucht dem Ermittler ein politisches Motiv aufzudrängen, sei doch das Opfer Bezirksrat für die antimarxistische Einheitsliste gewesen, und verweist auf die Ereignisse im burgenländischen Schattendorf.
Dort hatten am 30. Jänner 1927 Mitglieder der rechtsextremen „Frontkämpfervereinigung Deutsch-Österreichs“ (die 1935 wegen NS-Affinität verboten wird) auf Republikanische Schutzbündler geschossen und dabei zwei Menschen getötet. Der im Juli stattfindende Prozess, bei dem der nationalsozialistische Frontkämpfer Walter Riehl seine Gesinnungsgenossen verteidigt, stellt die parallel mitlaufende Geschichte in Pittlers Kriminalroman dar. Sein 44-jähriger Ermittler verfolgt die Prozessberichterstattung in der amtlichen „Wiener Zeitung“ wie auch im sozialdemokratienahen „Kleinen Blatt“. Als promovierter Historiker und Politikwissenschaftler hat der 44-jährige Sachbuch- und Prosaautor nicht nur die betreffenden Artikel in seinen quer durch alle sozialen Schichten führenden, idiomreichen Krimi eingearbeitet. Sein profundes Wissen um die politischen, sozioökonomischen und alltagskulturellen Verhältnisse sorgt für die detailgenaue Rekonstruktion eines links regierten, doch ideologisch entzweiten Wiens, das den Keim des Bürgerkriegs bereits in sich trägt. Oberstleutnant Bronstein – Held seiner 2008 begonnenen Krimiserie rund um die Erste Republik – situiert Pittler in der Mitte dieser Grabenkämpfe. Der regierungsloyale Beamte lobt die rote Sozialpolitik Wiens, seiner scheinbar einzigen Ex-Freundin sieht er gar die Beteiligung am kommunistischen Putschversuch 1919 nach und er reagiert allergisch auf deutschnationale Umtriebe. Trotz der traditionellen Polizistenmahlzeiten Leberkäsesemmel und „Beamtenforelle“ ist Bronstein ein Freund lukullischer Genüsse und dem Alkohol nicht abgeneigt. Am Wochenende wettet der Protestant jüdischer Herkunft bei Pferderennen in Baden oder fährt auf Sommerfrische zum Semmering, den Abend verbringt der sexuell depravierte Junggeselle bei Wagners „Ring“ in seiner Wohnung in Margareten. In ihm liegt denn auch das einzige Problem dieses und des Vorgängerkrimis verwurzelt: Pittler bemitleidet seinen Ermittler zu sehr, sodass Bronsteins Lamento über sein fehlendes Liebesleben manchmal zuviel Spannung wegnimmt.
Ezzes endet mit einem ungewöhnlichen Umgang mit dem Ermittlungsendbericht und den Tumulten nach dem Schattendorfer Prozess-Fehlurteil. Tausende Menschen demonstrieren am 15. Juli 1927 an der Wiener Ringstraße, die Polizei erhält einen Schießbefehl, der Justizpalast – in dem Bronstein und die Tatverdächtigen eingeschlossen sind – brennt, 89 Demonstranten werden getötet. Eine Wunde, die nicht mehr heilt.
Der Vorgängerroman Tacheles (Wien live edition 2008; 301 S.; Euro 9,90; ISBN 978-3-901761-87-4) spielt im ebenfalls geschichtsträchtigen Jahr 1934.
David Bronstein hat die nach dem Justizpalastbrand erhaltene Ehrenauszeichnung genützt, um den Justizwachebeamten Andreas Cerny an Pokornys Stelle zu hieven. Cerny, 37-jähriger Major tschechischer Abkunft, stellt das dar, was der 50-jährige und seit drei Dekaden im Dienste der Wiener Polizei stehende Bronstein sich nur erträumte. Er ist verheiratet, charmant, intellektuell gebildet und hat Kinder.
Bronstein, dessen Urgroßvater ein jüdischer Bader aus Galizien war und dessen Großvater sich einer Arztstelle in Wien wegen taufen ließ, liest seine „Wiener Zeitung“ im Literatencafé Herrenhof, raucht „Donau“-Zigaretten und sinniert trinkend über seine Einsamkeit. Als Oberstleutnant kann er sich eine Wohnung in der Innenstadt und eine Haushälterin leisten, nicht aber die bezahlte Befriedigung seines sexuellen „Notstands“.
Ende Juni 1934 wird am Wiener Judenplatz Emanuel Demand, protestantischer Genuss- und Nahrungsmittelfabrikant jüdischer Herkunft in dritter Ehe, brutal erschlagen. Cerny und Bronstein – von Befragten als „a Behm und a Jud“ tituliert – verfangen sich alsbald in einem Dickicht geschäftlicher, politischer und amouröser Motive. Abermals versucht die nunmehr austrofaschistische Politik – hier durch Polizeivizepräsident Skubl vertreten – in Richtung sozialdemokratischer Täterschaft zu lenken, da eine solche das nach dem Februarputsch erfolgte Betätigungsverbot post factum untermauerte. Die NS-Gefahr aber unterschätzt man.
Bronstein, der sich nie als Jude sah, schlagen bei seinen Ermittlungen nicht nur in politischen Gefilden Antisemitismen aller Art entgegen: „Viel zu lange hatte er diese Frage konsequent ignoriert, hatte Antisemitismus für ein Problem gehalten, mit dem nur orientalische Flickschuster auf der Mazzesinsel oder orthodoxe Rabbis aus der Seitenstettengasse konfrontiert waren“. Pittler, der über deutschvölkische Tendenzen in der FPÖ diplomierte, nennt die deutschvölkisch, ökonomisch, polit-katholisch und kulturell basierten Diskursstereotypen beim Namen: vom „Shylock“ aus Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ und pejorativ gemeinten „Itzig“ ist ebenso die Rede wie vom biologistischen „Blutsauger“, dessen „raffendes Kapital“ und Sittenlosigkeit den „Volkskörper“ schädige. Selbst bei einer Anbahnung mit einer Prostituierten und dem schließlich mit einer Zeugin erfolgenden Geschlechtsverkehr verfolgt Bronstein, dem Talmud und Zionismus fern stehen, die „Judenfrage“, während er von religiösen Juden Goi genannt wird. Hier kommt Pittlers positiv zu wertendes Kalkül zu tragen, eben einen erfolgreichen „jüdischen“ Staatsbeamten als Helden eingeführt zu haben, dessen Herkunft ihm von seiner antisemitischen Umwelt aufgedrängt wird. Denn woran es diesem Land Schönerers, Luegers, Kunschaks und Hitlers stets mangelte, war und bleibt das Sichtbarmachen der Leistungen und Erfolge von Minderheiten. Demgemäß verwendet Pittler neben seinen Buchtiteln viele Dialoge in jiddischer Sprache, um deren Eingang ins Deutsche – von Massl bis Schmock – aufzuzeigen.
Bronstein beginnt denn auch seinen Wagner und Schiller mit Mendelssohn und Zweig auszutauschen, während die als Täter verdächtigten Nationalsozialisten – im Unterschied zu sozialdemokratischen Fabrikarbeitern nicht ihres Posten enthoben – von der Abschaffung des „Schand- und Knebelvertrag[s] von Wersai und Säu Schermäu“ und jener der „jüdische[n] Plutokratie“ träumen. Denn die Vorbereitungen zum Juliputsch sind im Gange. Wie im Nachfolgeroman „Ezzes“ ist das Verbrechen bereits aufgeklärt, als Bronstein in ein weit geschichtsmächtigeres Ereignis involviert wird. Die frei gelassenen, von der (vielfach bereits ins NS-Lager gewechselten) Exekutive freilich unbeschatteten Nazis fahren als Bundesheersoldaten verkleidet im LKW von einer Turnhalle im 7. Bezirk ab, einzig Bronstein rast ihnen zum Bundeskanzleramt hinterher. Dort trifft er auf Dollfuß, den die Putschisten töten. Die Schlussszene besteht aus den letzten Gedanken des sterbenden „Ständestaats“-Regenten, die – im Pathos der Parallelisierung verunglückt – an jene des am Buchanfang sterbenden Fabrikanten erinnern.
Andreas P. Pittlers Kriminalromane um den Chefermittler Bronstein überzeugen – neben der zeitgeschichtssicheren Wiederheranführung an die Epoche der Ersten Republik und der austrofaschistischen Diktatur – mit Esprit in der Nachzeichnung von Alltagskultur und altösterreichischem bzw. Wiener Idiom. Man ist affrontiert und verlustiert sich gleichwohl.