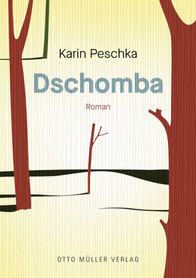Peschka hat bereits ihren ersten Roman Der Watschenmann (2014) dieser Epoche gewidmet. Ort der Handlung war da noch die Großstadt Wien, das neue Buch hingegen spielt im ländlichen, oberösterreichischen Raum in mehreren Orten nahe Eferding. Die Brücke zwischen den beiden Romanen bildet Dragan Džomba. Wie schon bei Fanni aus den Romanen FanniPold (2017) und Putzt euch, tanzt, lacht (2020) lässt Peschka auch hier einer Romanfigur in einem zweiten Buch eine gewisse Wiedergutmachung zu Teil werden, verlässt Džomba doch am Ende von Watschenmann seine Nächsten für eine höchst ungewisse Zukunft. Für sie hatte er schlicht jeden Nutzen und jede Notwendigkeit verloren.
Zu Beginn von Dschomba sieht es gar nicht gut für die Hauptfigur des Romans aus, Džomba tanzt – mehr oder weniger nackt, so genau ist die Erinnerung in der Erzählung nicht – auf einem Friedhof. Es besteht die Gefahr, dass dieses beängstigende Schauspiel die ländliche Bevölkerung zu einer gewalttätigen Reaktion veranlassen könnte, bis sich der Dechant der Gemeinde zu dem Fremden begibt und damit den Anfang für eine Beziehung setzt, die immer weitere Kreise zieht, immer mehr Menschen in ein Geflecht miteinander bringt, das keinen unverändert lässt. Der zentrale Ort ist dabei der Friedhof Deinham, auf dem an die 6000 Verstorbene des ehemaligen Kriegsgefangenlagers bei Aschbach und Hartkirchen aus dem Ersten Weltkrieg liegen. Doch: „Brauchst nicht glauben, dass die Toten tot sind“, wurde Dragan schon als Kind in Serbien belehrt – und nicht nur darin war der Auftrag begründet, den er mit der Suche nach seinem verschollenen Bruder zu erfüllen hat. Dass er im Nachkriegsösterreich nicht der Einzige mit einer Geschichte ist, die es ihm schwer macht, sich ihrer zu erinnern, ist nachvollziehbar.
Karin Peschka ist eine österreichische Schriftstellerin, nicht zuletzt durch die Wahl ihrer Themen und Orte, zugleich aber auch sehr unösterreichisch: Vor allem dadurch, dass ihre Figuren im Grunde gut sind, zumindest zum überwiegenden Teil, und ohne dass sich auch nur ein Hauch von Kitsch oder Rührseligkeit in die Erzählung einschleichen würde. Der österreichische Katholizismus ist ein weiteres großes Thema, allerdings auch in diesem Fall mit einer ungewöhnlichen Perspektive: Zwar werden genug Kreuze einfach eingepackt und verräumt, die beiden geistlichen Figuren des Romans werden jedoch ungewöhnlich positiv gezeichnet. Zuweilen kommt fast eine Art „Don Camillo und Peppone“-Stimmung auf, wobei sich im Dechant die beiden Personen zu verbinden scheinen, wird doch über den Priester geraunt: „Wär kein Geheimnis gewesen, dass der seit jeher ein verkappter Kommunist war.“ (S. 352) Die Figurenzeichnung von Peschka geht über das Holzschnittartige – und auch Sentimentale – der Bücher und Filme aus dem Kalten Krieg hinaus. Es ist geradezu ein Markenzeichen von Peschkas Büchern, dass sie ihren handelnden Personen so lange wie möglich ihr Geheimnis belässt. Selbst Nebenfiguren erfüllen auf diese Weise nicht nur ihre Aufgabe für die Handlung, sondern gewinnen – gerne auch an unerwarteter Stelle – an Profil und individueller Tiefe. Niemand geht im Personengeflecht von Peschkas Roman verloren, nicht der Mesner, nicht die vorbeiradelnden Buben, die Haushälterin Agnes und schon gar nicht der von allen belächelte Kleinhäusler Silvester. Dazu gehört auch, dass Peschka Ironie, Sarkasmus und – unbedingt – Zynismus in ihrem Schreiben meidet. Das bedeutet nicht, dass ihre Sprache simpel wäre. Bedeutungen und Bilder erschließen sich oft erst im Nachhinein, nicht nur für die Figuren, sondern auch für die Lesenden.
Ein zweites Zentrum, neben dem Friedhof und weitaus weniger dramatisch, ist das Wirtshaus. Mit geringen Änderungen würden sich diese Passagen, deren autobiografische Prägung offensichtlich ist, aus der Haupterzählung lösen und zu einem eigenständigen literarischen Text zusammenfügen lassen. Im Roman selbst bewirkt die Schilderung des Wirtshauslebens aus der Sicht der Tochter, eines „Wirtskindes“, Jahrzehnte nach den Ereignissen der Haupthandlung eine Entschleunigung des Geschehens. Zwar stellt sich dieser Effekt schon durch die Verknappungen in Dialogen und Sprache des Romans ein, die zu einer Verlangsamung des Lesens zwingen; Szenen wie jene, in denen das Wirtshaus nach Betriebsschluss langsam zur Ruhe kommt, sind aber bei Peschka von ähnlich starker Wirkung wie die dramatischen Momente im letzten Drittel. In diesem gewinnt die Handlung in gleichem Ausmaß an Rasanz, als sich die inneren und äußeren Konflikte der Personen nicht mehr bändigen lassen. Davor ist genug Zeit gewesen, ihre Figuren auf eine Art und Weise kennenzulernen, dass ihr Schicksal niemanden mehr gleichgültig lassen kann. Auch das zeichnet Karin Peschkas Literatur aus.