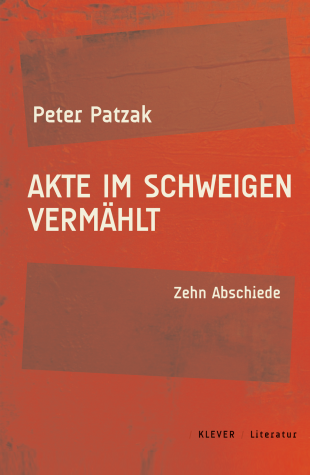Der Prosaband mit dem originellen, aber etwas irreführenden Titel – „Akte“ kann in drei verschiedenen Bedeutungen verstanden werden – ist das Buch zum Theaterstück, das 2008 im Stadttheater Walfischgasse uraufgeführt wurde. Es ist aber kein typischer Bühnentext in Dialogform; die meisten Texte bestehen aus langen Monologpassagen, immer wieder in Form von Briefen. Nur gelegentlich mischt sich eine andere Stimme in das Gesprochene ein, widerspricht oder verteidigt sich; dazu gesellt sich noch ein neutraler, wissenschaftlicher Kommentar, der vom Lebensende der jeweiligen Personen berichtet. Im Ganzen sind die zehn Geschichten formal wie auch sonst in jeder Hinsicht ganz und gar unterschiedlich – ein sicheres Kennzeichen eines gelungenen Sammelbandes. Mal sind es Briefe (der Freundin, der Ehefrau, der Prostituierten), mal einfach spontan vorgetragene Monologe, dann wieder Erzählungen aus der Sicht eines Dritten.
Akte im Schweigen vermählt präsentiert auf sehr anregende und oft unterhaltsame Weise zehn weibliche Biographien, die unterschiedlicher kaum sein könnten: nur die Tatsache, einmal einem bekannten Maler Modell gestanden zu sein, verbindet die Frauenviten. Zeitlich erstreckt sich die Spanne von 1663, als Rembrandts Lebensgefährtin stirbt, bis 2004 – ein zufälliges Modell Edward Hoppers, übrigens selbst Malerin, entdeckt sich zufällig in einer Ausstellung. In den ersten Texten wird die erschreckende Benachteiligung der Frau in einer männlich bestimmten Gesellschaft, von der die Kunstwelt durchaus keine Ausnahme machte, deutlich. Der Leser/die Leserin kann die Erzählenden nur als ausnahmslos bedauernswerte, ausgenutzte und wieder verlassene Geschöpfe begreifen, als Opfer des männlichen Egomanentums. Das verbindet die Protagonistinnen anfangs tatsächlich; doch sehr bald tauchen immer mehr Modelle auf, die – voll und ganz heutigen emanzipatorischen Gedanken entsprechend – genauso leben, denken und vor allem handeln wie Männer. Irgendwann werden die Rollen zwischen Mann und Frau, zwischen Maler und Modell vertauscht. Sind die ersten Porträtierten noch durchwegs Prostituierte, die um ihr zusätzliches Honorar geprellt wurden, so posieren in der Folge eher Geliebte oder Lebensabschnittspartnerinnen der unsteten Künstler; schließlich langt der Autor bei Frauen an, die in ihrer Rolle als Modell (oder auch als Tochter eines Künstlers) die Malerei lernen und sich in weiterer Folge als finanziell und künstlerisch autonome, promiskuitiv lebende Künstlerinnen (Subjekte, nicht mehr Objekte) kaum mehr von ihren männlichen Kollegen unterscheiden.
Dabei ist die Zeit, in der diese Frauen lebten und wirkten, nicht unbedingt entscheidend für ihr persönliches Glück oder Unglück: während Hendrickje Stoffels, die deutlich jüngere Lebensgefährtin Rembrandts, Mitte des 17. Jahrhunderts in bitterer Armut, aber als glückliche Frau und Mutter in inniger Liebe und Freundschaft zu dem unabhängigen, sich selbst treuen Maler stirbt, wird Ida Hammershoi, die rechtmäßige Ehefrau von Vilhelm Hammershoi, an der Seite des schweigsamen, gesellschaftsscheuen dänischen Künstlers des beginnenden 20. Jahrhunderts mehr oder weniger lebendig begraben: er tötet ihren Frohsinn und zwingt sie zu einem Leben in Stille und Ereignislosigkeit. Besonders berührend im Übrigen auch die Geschichte der blutjungen Fränzi Fehrmann: der Brücke-Künstler Ernst Ludwig Kirchner nimmt die erst 13-Jährige (!) mit zu einem Landaufenthalt und bringt ihr die Liebe und ein bisschen Malerei bei, um sie zwei Jahre später zu verlassen, mit dem Argument, sie sei ihm zu wenig gebildet. Andererseits begegnet man auch durchaus grotesken, weniger tragischen Lebensläufen, wie etwa dem der steinalt gewordenen amerikanischen Malerin Sue Bonaccia, die zwar alle Höhen und Tiefen eines Künstlerlebens durchlebt, Männer für sich benutzt und die halbe Welt bereist, deren Bilder aber merkwürdigerweise immer wieder durch irgendeinen Unfall zerstört werden.
Gemeinsam ist den „Akten“ des Stücks schließlich noch eines: alle Geschichten warten mit einem surrealen, manchmal versöhnlich-schönen, meist aber tragikomischen Ende auf. Die zum Schweigen verurteilte Ida überlebt ihren Mann um 33 Jahre; Schiele stirbt fast zeitgleich mit seiner neuen Liebe, nachdem er sein wichtigstes Modell Wally Neuzil verlassen hat; die Nähmaschine von Juliette Huais, einer Geliebten Gauguins, überlebt die Besitzerin und wird später von Joan Miro zu mehreren Skulpturen verarbeitet; Rembrandt malt das Bild zu Ende, für das ihm seine geliebte Hendrickje noch als Tote posiert, Ernst Ludwig Kirchner begeht Selbstmord, Suzanne Valadon, Muse der französischen Impressionisten, stirbt als gefeierte Malerin, zu deren Begräbnis „ganz Montmartre“ erscheint.
Peter Patzak, äußerst produktiver Film- und Theaterregisseur, Maler und Professor an der Filmakademie, ist einem breiteren Publikum vor allem als Autor der legendären Serie „Kottan ermittelt“ (in Zusammenarbeit mit Helmut Zenker) bekannt. Nach etlichen Literaturverfilmungen (Martin Walser, H. v. Doderer, Vicki Baum) gelingt Patzak in seinem Theaterstück eine sehr plastische und unmittelbare Darstellung der Künstlerwelt der letzten Jahrhunderte. Kenntnisreich und phantasievoll, einfühlsam und dabei stets mit einem humoristischen Unterton breitet er meisterhaft bis brillant formulierte Anklagen und Lebenserinnerungen von Frauen aus, denen er mit diesem Buch ein Denkmal setzt. Die zahlreichen Premierenfotos, aufgenommen von Sepp Gallauer und zusammengefasst in der Mitte des Bandes, geben einen Eindruck von der Wirkung des Textes auf der Bühne. Interessant ist hier der Kontrast zwischen dem traditionell weiblichen Habitus der Frauen und dem durchaus zeitgenössischen Bühnenbild mit großformatigen Projektionen.
Das Buch, eines der ersten des neu gegründeten Klever-Verlags, überzeugt in erster Linie durch die Vielfalt der Lebensformen, die der Autor – changierend zwischen Fakt und Fiktion – unter dem Rollenbild der „Künstlermuse“ zusammenfasst, nicht zuletzt aber auch durch stilistische Vielfalt. Eine hochinteressante Lektüre!