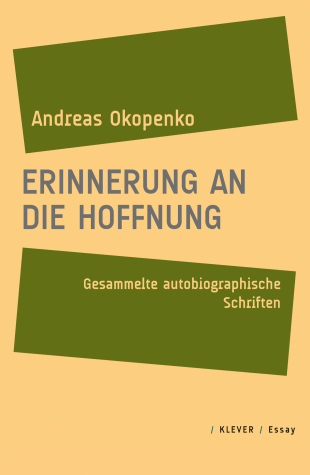Angesichts labiler historischer Verhältnisse verbrachte der Sohn und spätere Schriftsteller eine erstaunlich unbeschädigte Kindheit im slowakischen Erzgebirge, wurde zunächst von einem Hauslehrer unterrichtet und erlernte fast beiläufig Slowakisch, Ukrainisch und später etwas Rumänisch – und das nicht, um einem institutionell verfassten Europäertum zu huldigen, sondern schlicht weil es die Umstände erforderten. Gewiss, es bedurfte der Begabung eines Okopenko, um sich mehrere Fremdsprachen und höhere Mathematik quasi nebenbei anzueignen. Dass das Wunderkind obendrein Zeit für chemische Versuche erübrigte konnte, versteht sich von selbst.
Die Übersiedlung der Familie 1938 in die ephemere Karpatoukraine und die darauf folgende Emigration nach Wien-Ottakring machten Okopenko früh mit dem Gefühl des Fremd- und Andersseins vertraut. Aufgrund dieser höchst multikulturellen Prägung landete der Autor, wie er ausführt, unmittelbar in der ästhetischen Randständigkeit. Nicht zu unterschätzen dürfte im Hinblick auf seine schriftstellerische Entwicklung auch der Umstand sein, dass Okopenko nicht eine geisteswissenschaftliche Laufbahn einschlug, sondern Chemie studierte, was nach seinem Dafürhalten maßgeblich zur Ausbildung der ihm eigenen Poetik beitrug. Sein aus Querverweisen und Textbausteinen montierter „Lexikon-Roman“ aus dem Jahr 1970 zeigt daher, wie könnte es anders sein, Spuren einer „naturwissenschaftlich protokollarischen Gesinnung“, die eminenten Einfluss auf die österreichische Avantgarde ausübte.
Nicht unwesentlichen Anteil an der Herausbildung des Okopenko’schen Stils hatte gewiss auch die „Sprachzerrüttung“, in welcher der Verfasser von Gedichten, Romanen, Hörspielen und Chansons aufwuchs. Eine erhöhte Sensibilität für und Wahrnehmung von formalen Problemen schreibt sich insofern wie selbstverständlich in das von ihm skizzierte biografische Koordinatensystem ein.
Wer Interesse an poetologischen Fragestellungen bekundet, wird in Erinnerung an die Hoffnung mehr als fündig werden. Freimütig und fern jeglicher Dünkelhaftigkeit berichtet der Autor von künstlerischen Höhen und Tiefen und scheut sich nicht, auf literarische Schwächen mit der nötigen Selbstkritik einzugehen. Angehende Schriftsteller werden seine diesbezüglichen Ausführungen vermutlich nicht ohne Nutzen lesen, wie auch der Germanist die eine oder andere denk- und zitierwürdige Passage in den autobiografischen Aufzeichnungen des Dichters entdecken wird.
Das einstige enfant terrible der österreichischen Avantgarde ist zwar leiser, aber beileibe nicht banal geworden, und wenn es unprätentiös Bilanz über sein Leben und Schaffen zieht, dann gilt uns dies lediglich als Bestätigung seiner längst vollzogenen Kanonisierung: Okopenko, der Politische, der Erneuerer, der Engagierte, der Feminist, hat seinen festen Platz in der österreichischen Literaturgeschichte, selbst wenn sein Schreiben (und das ist kein Schaden) meist abseits des mainstream stattgefunden hat.