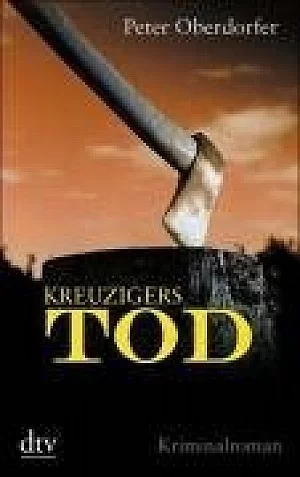Mit der Klärung dieser Frage wird der Dorfpolizist beauftragt, der „in der Zentrale den Ruf eines störrischen, arbeitsscheuen Faulenzers“ hat. (S.25) Keine ganz leichte Aufgabe, denn mehrere Personen machen sich verdächtig: Der an Gott leidende Priester, ein bekannter Maler, die verbitterte „Dorfalte“, sie alle scheinen in diesem Mordfall eine dubiose Rolle zu spielen.
Zudem übt Chefinspektor Doktor Gschnitzer gehörig Druck aus. Der hat es dem Ich-Erzähler nicht verziehen, dass er in jungen Jahren aufdeckte, was eigentlich hätte verborgen bleiben sollen. So ist aus einem „der besten Absolventen der Polizeischule, die es je gegeben hat“, ein Dorfpolizist geworden. Offizielle Version: Weil er sich bei den Ermittlungstätigkeiten im Dorf so hervorragend bewährt hat, solle er gleich bleiben und die Amtsgeschäfte weiterführen.
Und nun also wieder ein Mord. Eine der Spuren weist auch in die Vergangenheit. War ein im Dritten Reich erlittenes Unrecht Motiv dafür?
Ungewöhnlich und wohltuend an Oberdorfers Erstling ist, dass er im Gegensatz zur sonst üblichen Austro Krimi Produktion keinen lustig-flapsigen Ton anschlägt, sondern sich um Ernsthaftigkeit bemüht. Ironisches mischt sich nur ab und an in die Handlung, etwa wenn der Ich-Erzähler über die Liebe des Polizisten zum Schnauzbart räsoniert, grundsätzlich aber gilt: der Krimi-Plot und die psychologische Zeichnung der HandlungsträgerInnen stehen im Vordergrund, nicht die Pointe.
Das wird auch in den Dialogen deutlich. Für „Lustigkeiten“ ist kaum Platz; zu sehr leiden die Personen an ihrer Existenz: dysfunktionale Familien; die Last der Vergangenheit; die Starrheit der gesellschaftlichen Strukturen, die Selbstentfaltung nicht zulassen. Dass die Dorfbewohner ihre Gedanken äußerst beredt zum Ausdruck bringen, lässt die Dialoge zuweilen etwas papieren und konstruiert wirken. Ein „Halbstarker“ beklagt die dörfliche Ereignislosigkeit wie folgt: „[…] es gefiel mir, dass in diesem verfluchten Dorf endlich einmal etwas passierte, von dem man nicht am nächsten Tag sagen würde: Es war nichts. Etwas, das die scheußliche Leblosigkeit hier, die betonierte Stille, diese große Nichts-Glocke, die immer, tagein, tagaus, über dem Dorf hängt, zerreißt, verstehen Sie!“ (S.57)
Auch wie Befindlichkeiten besprochen werden, lässt eher an Menschen mit Therapie- oder zumindest (passiver) Talkshow-Erfahrung denken als an verschlossene Dörfler aus den Siebzigern.
Oberndorfer interessiert sich dafür, was Menschen antreibt. Er versucht, seine Figuren so genau als möglich zu zeichnen. Dennoch geraten sie manchmal ein wenig unglaubwürdig. Der Assistent des Ich-Erzählers, von dem es anfänglich heißt, er spreche wie ein Kind (S.8), mausert sich innerhalb weniger Tage zum scharfzüngigen Karrieristen: „Genau das ist es, Herr Wachmann: Da gibt es kein ‚aber‘. Leute wie Sie werden nie verstehen, wie einfach das Leben eigentlich ist. Es ist so einfach, dass man es geradezu für einen Scherz halten könnte. Aber [sic!] passt in einen Querkopf wie den Ihren einfach nicht hinein. Dabei wäre Ihr Gehirn durchaus leistungsfähig. Diese vielen grauen Zellen, die sich so vergeblich quälen, finden Sie das nicht schade?“
Reichlich konstruiert und bizarr wirkt auch der Auftritt einer Asiatin, die mit dem örtlichen Maler ein abgelegenes Gehöft bewohnt und dem Kommissar mit Busen, Peep-Show-Geturne und Exotik-Eros die Sinne schwinden lassen soll.
Trotz dieser Unstimmigkeiten ist Oberdorfer ein brauchbares Debut gelungen, das Neugier auf mehr macht. Die Untiefen des Alltags sollten unbedingt weiterhin ausgelotet werden.