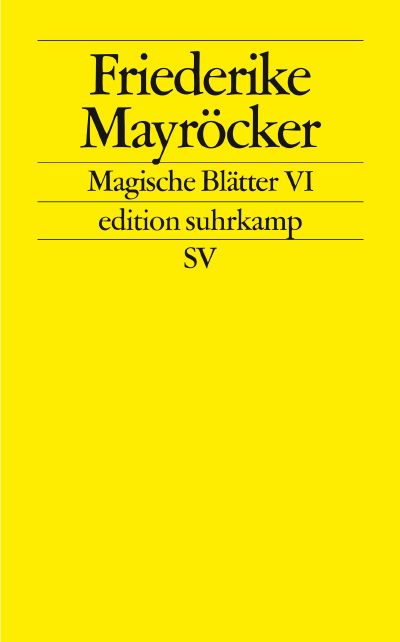Wer Mayröcker nicht kennt und Mayröcker nicht liebt, wird sich von ihrer zwischen Lyrik und Prosa schwankenden Privatsprache vor den Kopf gestoßen fühlen. Es bedarf nämlich einiger Lektüreerfahrung und guten Willens, um sich als Uneingeweihte(r) auf die Hervorbringungen ihrer eigenwilligen Poetik einzulassen. Zu assoziativ scheint die Syntax, zu opak der Ausdruck, zu sprunghaft die Faktur ihrer Texte. Beharrlich rückt die Dichterin dem Wortmaterial an den Leib, schüttelt und rüttelt es, sucht nach Wohlklang und Rhythmus, um scheinbar beiläufig Sinn zu erzeugen, der gemäß Derridas différance unendlich vorläufig bleiben muss. Immer wieder verfängt sich das Textsubjekt dergestalt in Sprachspielereien, Alltagswahrnehmungen und Reminiszenzen, in deren Mittelpunkt seine (eigentlich „ihre“) Seelen- und Künstlerfreundschaft mit EJ alias Ernst Jandl steht.
Jandls Andenken wird mit der wehmütigen Gewissheit unwiderruflicher Abwesenheit beschworen und in berührenden Passagen gefeiert, wobei die Ambivalenz des Gedächtnisses als bloß geistiges Da-sein schmerzlich bewusst wird, wenn die Autorin etwa notiert: „Und es nähert sich alles was war, aber es ist nicht mehr da.“
Erinnern, Schreiben – davon spricht uns diese Prosasammlung, die Bücher, Gemälde, Orte und Menschen in Kommentaren, diversen Essays, Hommagen, Hörspielen, Reden vorbeidefilieren lässt und vorführt, wie sich Werk und Biografie aufs Anmutigste zu verschränken wissen.
Man schlage das Taschenbuch an einer beliebigen Stelle auf und lasse sich von der Stimmung, von der Lust am Entdecken treiben. Man mache sich von hinten, von vorn an die Magischen Blätter heran, als gelte es, die Mayröcker zu überraschen. Und schon sind wir gefangen, Gefangene dieser intertextuell vernetzten, montierten Prosa, aus deren Hintergrund die Stimme Derridas je und je ertönt. Durch die Textlandschaft flanierend, empfangen wir ihre ästhetischen und intellektuellen Reize und erhalten unversehens Zugang zur Privatsphäre der Dichterin, die uns als Verletzliche und Abschied Nehmende rührt. Dabei stoßen wir immer wieder auf Beglückendes – darunter den schönsten Text, der je über die Stadt Graz verfasst worden ist. Mayröcker sei Dank!
Mayröckers Verdienst besteht fraglos in einer Sprachkunst, die nach originellen und selbstredend nicht marktgängigen Ausdrucksformen sucht, denn „so kann man ja nicht mehr schreiben wie vor 30 Jahren“. Wer sich dergestalt der Ästhetik verpflichtet fühlt – und an dieser Stelle dürfen Bedenken angemeldet werden -, läuft freilich Gefahr, sich trotz Kanonisierung selbst in eine Nische der Literaturgeschichte zu verbannen. Mayröcker produziert Mayröcker auf höchstem Niveau, was betört, betäubt, ja süchtig machen kann. Aber man muss, wie gesagt, Mayröcker mögen …