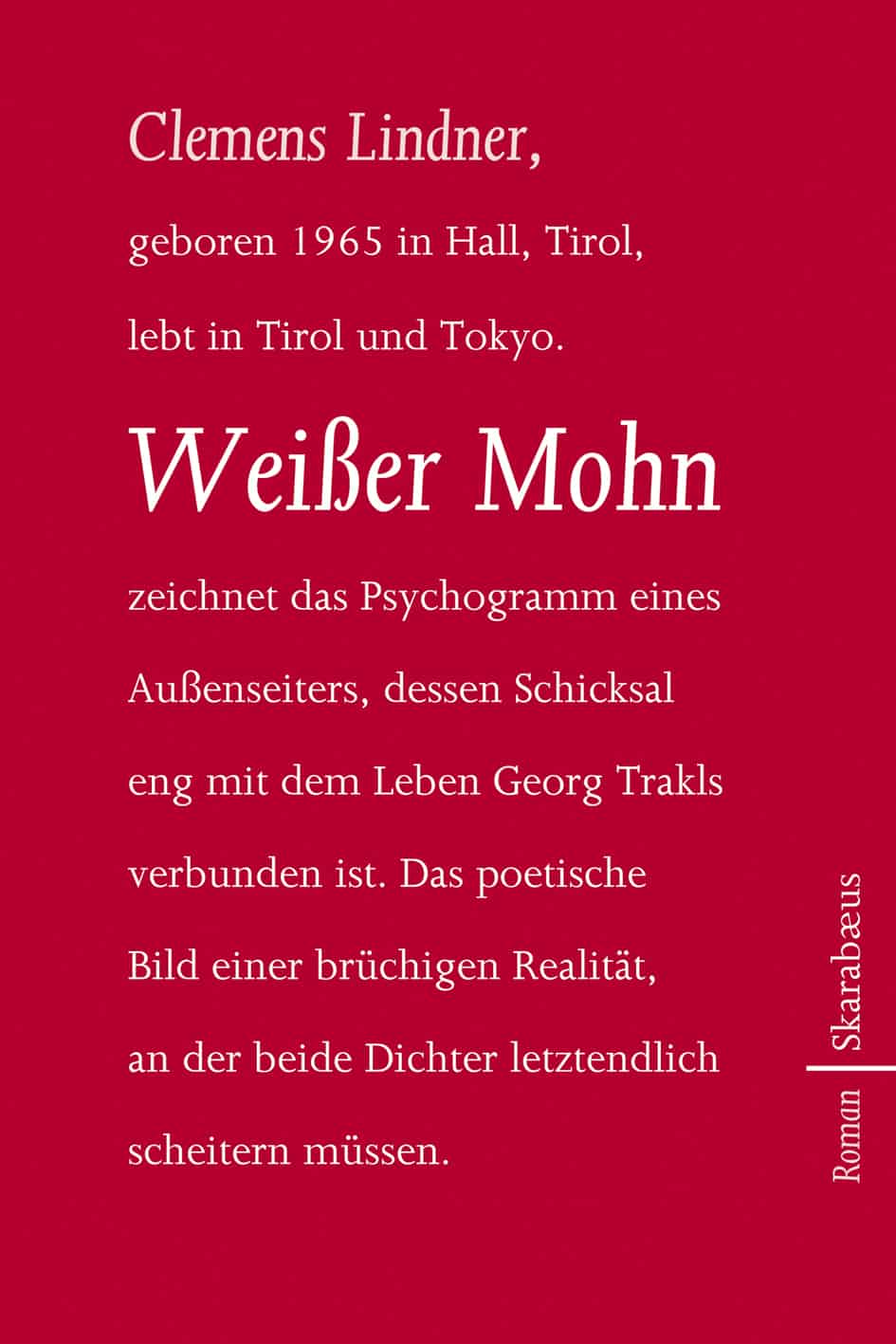Auch Sebastian Hauser, die Hauptfigur in Clemens Lindners Roman Weißer Mohn, wünscht sich, der Wirklichkeit zu entfliehen. Er betäubt sich mit Drogen und Alkohol, verschanzt sich hinter Büchern, identifiziert sich mit toten Dichtern, mit Baudelaire, Heine, Beckett, Trakl, er „sucht überall Tote, um sie zu benützen für seinen Spleen.“
„Hausers Leben“, so heißt es in Weißer Mohn, „war wie ein Gedicht von Trakl.“ Die Lyrik dieses expressionistischen Dichters war geprägt von Schwermut und Trauer, Leitmotive waren Nacht, Vergänglichkeit, Tod und Verfall. Eine besondere Rolle spielte auch die vermutete inzestuöse Beziehung zu seiner Schwester Margarethe, die als geheimnisvolle Fremdlingin und Jünglingin durch seine Gedichte geistert. Endgültig gebrochen durch das Leiden an der Wirklichkeit des Krieges nahm sich Trakl im November 1914 das Leben; er starb an einer Überdosis Kokain.
Sebastian Hauser nimmt sich diesen Außenseiter zum Vorbild, er inszeniert sein Leben als Wiederholung der Biographie Trakls, sondert sich von seinen Altersgenossen ab, gibt sich leidend und verzweifelt, pilgert beinahe täglich an Trakls Grab, schreibt Gedichte in seinem Stil und verstrickt sogar seine Schwester Judith, seine eigene „Fremdlingin“, in eine zerstörerische inzestuöse Beziehung, der erst ihr Selbstmord ein Ende setzt.
Anfang 1991 verlässt Hauser sein Tiroler Heimatdorf und geht nach New York, auf der Suche nach Anonymität, nach Aufregung, nach Abenteuer und findet sich doch nur einsam wieder, „unglücklich und verlassen“ – „das Bild der Stadt war größer und herrlicher als die Wirklichkeit.“ Die Wirklichkeit, wie Hauser sie erlebt und reflektiert, entpuppt sich einmal mehr als abgründig und brüchig.
Würde sich der Roman auf Hausers Perspektive beschränken, dem Leser würde ob all seiner arroganten Selbstüberschätzung, seines pubertären Selbstmitleids und koketten Lebensekels bald der Geduldsfaden reißen. Doch Lindner weiß um diese Gefahr und wählt daher wechselnde personale Erzählperspektiven und unterschiedliche Textsorten, um zu seinem lebensunfähigen Antihelden auf Distanz zu gehen, ohne ihn jedoch der Lächerlichkeit preiszugeben.
In der Rahmenhandlung erinnert sich ein ehemaliger Schulkamerad, verheiratet mit Hausers Jugendliebe Klara, voller Abscheu und Wut an den Sonderling, als er überraschend von der gemeinsamen Vergangenheit seiner Frau und Hausers erfährt; Klara beschreibt rückblickend die Faszination, die das seltsame Geschwisterpaar Hauser auf sie ausübte, das sie bis heute in ihren Bann zieht. Hauser selbst teilt sich dem Leser in inneren Monologen und erlebter Rede mit und kommt zudem über den Abdruck seiner frühen literarischen Versuche zu seinem Stimmrecht. Das von ihm entworfene Bild wird durch fünfzehn Briefe konterkariert, die die rätselhafte, exzentrische Dominique an ihn, ihren anonymen nächtlichen Anrufer schreibt, Briefe, die sie jedoch nie abschickt, kennt sie doch weder Hausers Telefonnummer noch Adresse. So entsteht ein vielfach gebrochenes Porträt eines Außenseiters, dessen Leben einem Totentanz gleicht: rauschhaft, exzessiv, abgründig. Wie die Stadt New York selbst, wo sich die Wege Hausers, Dominiques und ihres Liebhabers Angel Andrades kreuzen. Mit schrecklichen Folgen: am Ende geschieht ein grausiger Mord. Hauser verlässt daraufhin die Stadt und folgt seiner Geliebten Yoshiko nach Japan, wo auch Klara ihn schließlich aufspürt und wo er, wie Georg Trakl, seinem jungen Leben ein gewaltsames Ende setzt. In welcher Beziehung all die Figuren dieses vielstimmigen Romans zueinander stehen und wie die einzelnen Handlungsstränge zusammenhängen, das erschließt sich dem Leser erst im Nachhinein – wenn überhaupt.
Lindner erlaubt sich ein postmodernes Spiel mit seinem Leser, narrt ihn mit Aussparungen und Anspielungen, die ins Leere laufen, legt und verwischt Spuren, spricht mit verschiedenen Stimmen und zitiert unterschiedliche literarische Genres. Narrative Passagen wechseln sich mit poetischen Einschüben ab, durchsetzt von Versen aus Gedichten Georg Trakls. Die einzelnen Versatzstücke folgen assoziativ aufeinander und verdichten sich zu einem labyrinthischen Netz aus Verweisen, das oft mehr verschleiert als erklärt. Doch behaupte niemand, Lindner hätte ihn nicht gewarnt:
„Ich blicke jetzt zurück auf ein paar Hundert von Gesichtern, zwei oder drei große Schaustücke, und vielleicht die Substanz von zwanzig Büchern. Ich habe nicht das Beste, auch nicht das Schlechteste von diesen Dingen behalten: es blieb, was konnte.“ Dieses Zitat Paul Valérys stellt Lindner dem Roman als Motto voran.
Geblieben sind Georg Trakls Gedichte und Biografie, Figuren und Szenen aus Pedro Almodovars La mala educación und John Carpenters Escape from New York, Zitate von Dante und Paul Klee und eine „CD mit den Liedern von Burt Bacharach.“ Sie alle und noch viele mehr haben Spuren hinterlassen in Lindners vielschichtigem, ungewöhnlichem, doch durchaus gelungenem Romanexperiment Weißer Mohn. Der Titel verdankt sich übrigens auch einem Vers Trakls, rätselhaft und melancholisch schön, wie Lindners Roman:
„Dem einsam Sinnenden löst weißer Mohn die Glieder.“