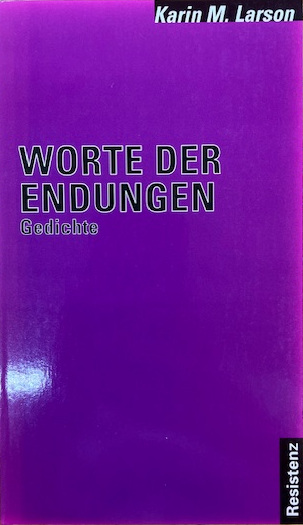Karin M. Larsons Gedichteband fällt erst einmal mit seinem ungewöhnlichen Titel auf, denn Worte der Endungen evoziert sowohl etwas Grammatikalisches als auch etwas Psychologisches im Sinne von Beendigung von Verhältnissen. Die neunzig Gedichte sind ohne Inhaltsverzeichnis abgedruckt, aber eine Menge Zwischentitel und „Lyrik-Reiter“ gliedern die Texte in überschaubare Abschnitte. Quasi als Leseanleitung sind die Kapitel immer wieder mit „Stimmungs-Anweisungen“ versehen, die ähnlich einer Regieanweisung am Theater einen lyrischen Fingerzeig abgeben. „Anbrechende Wellenkunst (Morgen)“, „Wunderlichkeit Suchen Staunen dunkle Sonnenstunden“, „Fallen Tränenreich / Sammle Kräfte (ich esse)“ oder „Reich der Schluchten Unsicherheit im Alltag“ lauten einige dieser Kommentare, die als Paßwörter zu den Gedichten nützlich sind.
Trennungen, kaputte Nächte und bedrohliche Tagschatten der Einsamkeit sind Motive, die in regelmäßigen Abständen auftauchen. Für Karin M. Larson sind die Gedichte nie fertig, immer wieder werden verschiedene Fassungen nebeneinader oder untereinander ausgelegt. Oft bleibt auch das Gedicht scheinbar gleich, aber die Jahreszeit oder der Zustand einer Beziehung haben sich verändert, so daß man einen Text einmal als Sommer- und dann wieder als Winterfassung erleben kann.
Einige Gedichte sind in englischer Sprache abgefaßt und klingen je nach Sprachkompetenz des Lesers wie Übungen zum Alltag, Transkriptionen einer SM-Nachricht oder Rohentwurf zu einem Song-Contest, der wegen der Globalisierung der Gefühle in Englisch abgefaßt ist.
Der Wechsel der lyrischen Formen ist manchmal sehr abrupt und kantig, was aber durchaus als Botschaft gedeutet werden kann. So ist etwa das Gedicht „der Tag“ (S. 80) graphisch schlank wie eine Säule aufgebaut, in dem jede Zeile bloß aus ein bis zwei Wörtern besteht, auf der Nachbarseite hingegen pirscht sich das Gedicht „Das Land ist unbezwingbar“ (S. 81) an die höchst konventionelle Form eines Mini-Sonettes heran.
Überzeugend sind jene Gedichte, in denen psalm-ähnlich die verflossene Liebe beweint wird oder das lyrische Ich sehr plastisch in den „Apfel der Bitterkeit“ (S. 52) beißen muß.
Eine gewisse Farblosigkeit entsteht, wenn große Begriffe mehr oder weniger zufällig ins Spiel gebracht werden. Das „Sein“ kann man seit Martin Heidegger entweder ironisch oder aber als tausendbändiges Zitat verwenden. Als schlechtes „Alltags-Sein“ im Sinne von „heute schlecht drauf sein“ ist das Sein ziemlich überfordert, da helfen oft nicht einmal fromme Rettungsversuche des Lesers. („Ein Tag zum Sein. Ein Tag um gut zu sein. Ein guter Tag zum Sein.“) (S. 91)
Ein endgültiges Urteil über die Lyrik Karin M. Larsons läßt sich natürlich nach diesem ersten Lyrik-Band nicht abgeben, aber die Texte verdienen es, daß man sich mit ihnen auseinandersetzt und sie mit der jeweils eigenen Leseerfahrung vernetzt.