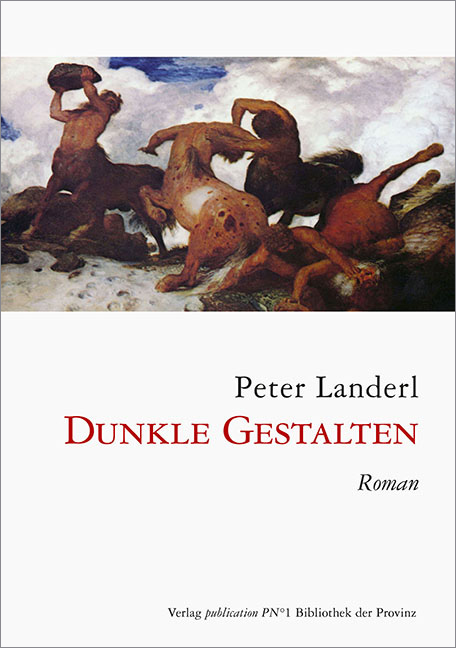Um seinen sterbenden Onkel, die einzige Bezugsperson seiner Kindheit, noch einmal zu sehen, kehrt der Ich-Erzähler Jakob, der in Straßburg lebt und alle Brücken zur Heimat längst abgebrochen hat, vorübergehend nach Oberösterreich zurück. Ein Zeitungsausschnitt bringt ihn, der sich für alte Kriminalfälle interessiert, auf die Geschichte des mehrfachen Vergewaltigers und Mörders Engleder, der zwischen 1951 und 1957 in der Gegend von Steyr und Sierning als „Mörder mit dem Maurerfäustel“ berüchtigt war. „Ich war wieder einmal sehr deprimiert. Da steckte ich mein Maurerfäustel in die rechte Rocktasche und fuhr los. Mit der Linken lenkte ich das Fahrrad, fuhr dicht an mein Opfer heran, und schlug es mit der Rechten auf den Kopf.“ So wird der kleingewachsene Arbeiter Engleder, Vater von vier Kindern, die Schilderung seiner Verbrechen später vor Gericht einleiten. Zwei Frauen überlebten seinen Frauenhass nicht, vier weitere wurden schwer verletzt am Tatort aufgefunden. Obwohl Engleder immer wieder gesehen wurde und grobe Fehler beging, tappte die Gendarmerie jahrelang im Dunkeln, verhaftete die falschen Verdächtigen und ruinierte so die Existenzen Unschuldiger. Man hätte aus dem Material auch einen Krimi machen können, doch geht es Landerl nicht um Suspense oder wohliges Gruseln. Er liefert vielmehr ein auf den ersten Blick nüchternes Protokoll der Bibliotheksrecherchen Jakobs zum Fall Engleder. Anfangs unmerklich wird der Roman so immer mehr zu einem faszinierenden und verstörenden Porträt der österreichischen Nachkriegsgesellschaft in dunklen Grautönen.
Bereits nach Engleders ersten beiden Attacken stößt Jakob in der Nationalbibliothek auf zahlreiche Berichte von Denunziationen, Verdächtigungen und wechselseitigen Anzeigen. Morde, Selbstmorde und Sexualverbrechen sind in den fünfziger Jahren genauso an der Tagesordnung wie aufgehetzte Menschenmengen, vor denen Tatverdächtige geschützt werden müssen. Die damalige Rechtssprechung macht stutzig – auf wiederholten Kindesmissbrauch stehen beispielsweise nur sechs Monate Haft -, die Zeitungskommentare mit ihrem unverhohlenen Ruf nach der Todesstrafe sind erschreckend zu lesen. In der Presse finden sich Formulierungen wie „es darf keine Schonung geben“, oder „man müsste dieses Scheusal lynchen“, die Namen von Verdächtigen werden in voller Länge abgedruckt. Wie zum Hohn schreibt die besonders sensationslüsterne Steyrer Zeitung von ihrer wichtigen Rolle bei der Prävention von Verbrechen, und nicht nur Jakob fragt sich angesichts der Selbstgerechtigkeit des Boulevards: „Was hat sich verändert?“ Besonders eindrucksvoll sind die Passagen, in denen Jakob die Berichterstattung verschiedener Zeitungen vergleicht. In einer Auflistung der Bezeichnungen für den Frauenmörder etwa ist von der „radelnden Bestie von Steyr“ zu lesen, vom „Scheusal aus Sierning“, vom „Hammerzwerg“ oder „Mordgnom“. In einem anderen Zusammenhang wären die Ausdrücke komisch, hier entfalten sie als Dokumente des Hasses eine gespenstische Wirkung.
Zumindest in einem Punkt irren die Zeitungen nicht: „Kerkergitter sind ein Schutz für Engleder, denn die Menge würde mit ihm anders verfahren, als es die Strafhausordnung vorsieht!“ Jakob sammelt die Aussagen der Schaulustigen, die vor dem Gerichtsgebäude auf den Prozessausgang warten: der Mörder müsse aufgehängt, vertilgt, oder gleich in Stücke gehackt werden. Die Epoche, in der Engleder seine Verbrechen verübte, ist jedoch nicht nur eine Zeit der hasserfüllten Zeitungskommentare und der gewaltbereiten Mobs, sondern gleichzeitig auch das goldenen Zeitalter von Heimatliteratur und -film, die die schwarze Vergangenheit Österreichs und seinen grauen Alltag mit buntem Kitsch zu übertünchen versuchten. Stellvertretend für die falschen Idyllen stehen in Landerls Roman die Dialektstrophen des „Sierningerlieds“, das Jakob als Kind auswendig lernen musste.
Drobn vom Hügl is in d’Weitn
so schen umanaundaschaun,
is des schenste Bildabüachl,
wo als Kind i blattlt han.
Ein weiteres Heimatgedicht folgt:
Letten ist mein Heimatdörflein,
In der Fremde kaum bekannt,
Doch für mich ist’s wohl das schönste,
weil dort meine Wiege stand.
Gedichtet vom späteren Sexualmörder Engleder. Wie ändert sich die Rezeption eines Textes, wenn er aus der Feder eines Mörders stammt? Jakob stellt sich solche Fragen immer wieder, liebt die Texte der französischen Rockgruppe Noir Désir, deren Sänger seine Lebensgefährtin im Drogenrausch erschlagen hat. Gewalt ist die Obsession des Erzählers, der die seelischen Verletzungen, die ihm sein brutaler Vater in der Kindheit zugefügt hat, nie überwinden konnte. Tagebuchartige Notizen seines alten Schulfreundes Johannes, der ihn kurz vor seiner vorübergehenden Rückkehr nach Österreich in Straßburg besucht, unterbrechen immer wieder den Haupttext und führen den Leser schrittweise zu einem besseren Verständnis von Jakobs Eigenart. Johannes genießt die schönen Seiten Straßburgs, die reiche Architektur, das entspannte Lebensgefühl der alten Studenten- und neuen Europastadt, Jakob hingegen zieht es auch hier zu den Abgründen, er zeigt Johannes die Stelle, an der im Mittelalter verurteilte Mörder langsam ertränkt wurden und ist fasziniert von den grauenvoll schönen Bildern des Isenheimer Altars, den er regelmäßig im nahen Colmar besichtigt. Johannes will den alten Freund besser verstehen, stöbert in seinen Zeitungsarchiven voller Mordfälle, bedrängt den an seine Einsamkeit gewöhnten Jakob und setzt so die Freundschaft aufs Spiel.
Mit Außenseitern und an Körper und Seele beschädigten Figuren hat sich Peter Landerl, dessen literatursoziologische Arbeit „Der Kampf um die Literatur“ im letzten Jahr erschienen ist, bereits in seinem ersten Roman „Happy together“ beschäftigt. Aus dem Blickwinkel des Außenseiters Jakob zeichnet der Autor nun ein ungewohntes, so eindrückliches wie bedrückendes Sittenbild der österreichischen Gesellschaft der fünfziger Jahre, das die dunkelgrauen Seiten ihrer Seele bestechend scharf in Szene setzt.