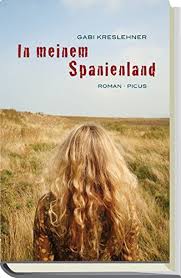Gabi Kreslehner erspart ihren Protagonistinnen und auch dem Leser nichts. Carmen wird von ihrer Mutter emotional vernachlässigt, von ihrem Stiefvater ins Bett genommen, ist zuerst zu dick, dann dank Bulimie zu dünn, haut immer wieder von zu Hause ab, aber nicht einmal die Sandler wollen etwas mit ihr zu tun haben, sie liebt unglücklich den großen Bruder ihrer Freundin, die drogensüchtig ist, ihren Körper eine Zeitlang mit Carmen als Zuhälterin verkauft und sich bald umbringt, und endet mit etwa achtzehn ohne Schulabschluss als Privat-Prostituierte eines ehemaligen Liebhabers ihrer Mutter. Da fehlt nur noch die Teenager-Schwangerschaft. Da gibt es keinen Lichtblick, so sehr sich der Leser auch einen wünschen mag; der zurückkehrende Vater ist natürlich ein liebloser Alkoholiker und verschwindet gleich wieder. Es gibt keine kleinen Schönheiten in Carmens Leben, an denen sie sich aufrecht halten könnte. Steffi geht von Mann zu Mann, will nicht altern, kocht überirdisch gut und außerordentlich unkonventionell, wenn sie traurig ist – was ein bisschen an Bittersüße Schokolade von Laura Esquivel erinnert – und findet am Schluss wenigstens einen Mann, der sie vielleicht für länger lieben wird. Ihr Gasthaus-Ehemann stirbt natürlich an einem Herzinfarkt, als er sie in flagranti mit einem Liebhaber erwischt.
Über der gerunzelten Stirn des erschütterten Lesenden schwebt von der Mitte des Buches an die Frage: Ist das in seiner Gesamtheit nicht ein bisschen gar dick aufgetragen? Um es bildhaft zu sagen: Wenn man sich zwanzig Mal an derselben Stelle anstößt, tut es nach dem achten Mal nicht mehr weh – wenn man sich dazwischen erholen kann, schmerzt es jedes Mal.
Formal hat das Buch zwei einander ergänzende Ebenen: ein Erzähler begleitet die Figuren chronologisch, dazwischen kommentiert in kursiv gesetzten Passagen Carmen selbst das Geschehen. Man sieht eine Interview-Situation vor sich, wenn Carmen erzählt, es wird nämlich auch beinahe jeder kursive Satz mit „sagt Carmen“ eingeleitet. Das ergibt eine interessante Rhythmisierung des Textes, wie Gabi Kreslehner überhaupt gerne mit Wiederholungen arbeitet, was dem inhaltlich so harten Text mitunter das Weiche der Lyrik verleiht: Ab da, sagt Carmen, hatte ich den Geruch nach Panier und Butterschmalz und Schokolade und Kaffee in der Nase und ab da, sagt Carmen, bekam ich den Geruch nach Panier und Butterschmalz und Schokolade und Kaffee nicht mehr heraus aus der Nase und ab da, sagt Carmen, sehe ich meine Mutter in der Küche, Schnitzel panierend und Gemüse schneidend und mit der Aushilfe, der alten Vettel, schimpfend. (17)
Dieser Rhythmisierung und Poetisierung unterwirft Kreslehner sogar die Satzzeichensetzung und verzichtet auf viele Beistriche. In dieser mitunter fast barock wirkenden Erzählweise gibt es aber auch Stellen von treffender Knappheit: Guten Morgen, sagte der Hammerer, wie hast du geschlafen? – Danke, sagte Steffi, gut, und biss herzhaft in ihr Honigbrot. – Das freut mich, sagte der Hammerer, und wo? (37)
Ein sprachlich überzeugendes, inhaltlich vielleicht ein bisschen übertreibendes Debüt also (fulminant, meint der Picus Verlag, was für Debüts anscheinend das Standardadjektiv ist), das die Erwartung an die weiteren Werke der Autorin Gabi Kreslehner schon recht hoch ansetzt.