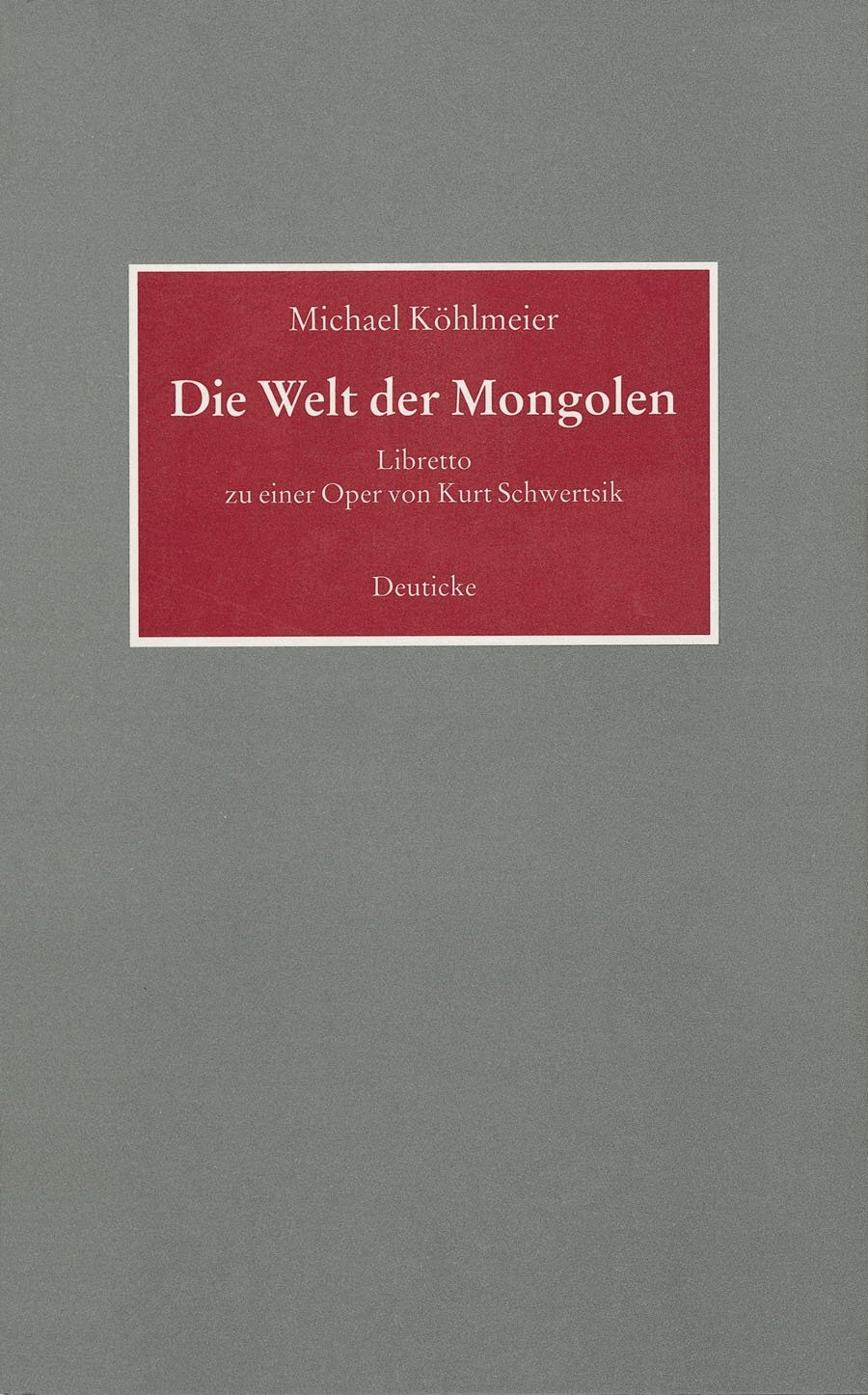Bereits Hugo von Hofmannsthal („Elektra“) und Stefan Zweig („Die schweigsame Frau“), um nur zwei bekannte Beispiele zu nennen, widmeten sich der Kunstform des Libretto und arbeiteten mit zeitgenössischen Komponisten (z. B. Richard Strauss) an der Synthese von Dichtung und Musik.
Diese Tradition erfährt seit geraumer Zeit eine rege Fortsetzung. Schriftsteller wie Robert Schneider, Peter Turrini, Harald Kislinger und nicht zuletzt Michael Köhlmeier treten in die Fußstapfen ihrer prominenten literarischen Ahnherrn, erfinden neu oder adaptieren Prosa- bzw. Theaterstücke für Film und Oper.
Die Oper war schon seit jeher Schauplatz großer Attraktionen und Emotionen. Auch Köhlmeier stürzt sich auf ein Thema von Welt, den Kampf zwischen Gut und Böse, transferiert in die nüchterne Atmosphäre der 90er Jahre.
Die Handlung in drei Akten ist schnell skizziert: Wilfried und Stefanie trennen sich aus Geldmangel an der Kasse zur Ausstellung Die Welt der Mongolen, wo an diesem Tag der hunderttausendste Besucher geehrt werden soll. Nach einem pathetischen Abschied zum Helden geworden, auch wenn er „nur Wilfried heißt“ (S. 31), entführt ihn ein Fremder namens Gunther in die benachbarte Werkstatt, die „Welt der Motoren“.
Im zweiten Akt sehen sich Wilfried und Gunther mit einem Chor von Killern konfrontiert, die nach dem Fremden suchen. Durch eine Finte gelingt es Gunther zu entwischen, während Wilfried niedergeschlagen wird und in einem tête-á-tête mit seiner Seele vom bevorstehenden Gemetzel im Museum erfährt.
Der Showdown läßt nur zwei Menschen am Leben: Stefanie und Wilfried, wen sonst. Nebenher wird einem klar, daß der Taxifahrer, der Fremde und die Killer nichts anderes sind als Allegorien auf den Tod, den Teufel und nunmehr flügellose Vertreter himmlischer Sphären.
Köhlmeiers humanitäres Anliegen, seine prinzipiell gerechtfertigte Kritik an der alltäglichen Gewalt kann nicht hinwegtäuschen über die Klischeehaftigkeit der vorgetragenen Ideale.
Herzschmerz gepaart mit Ritter-Retter-Helden-Ethos, sinnloses Abschlachten von unschuldigen Kulturreferenten und Museumsbesuchern enden letztlich in banalem Hungergefühl und dem Wunsch nach einem heimeligen Essen zu zweien. Ein Happy End also, wie es sich gehört.