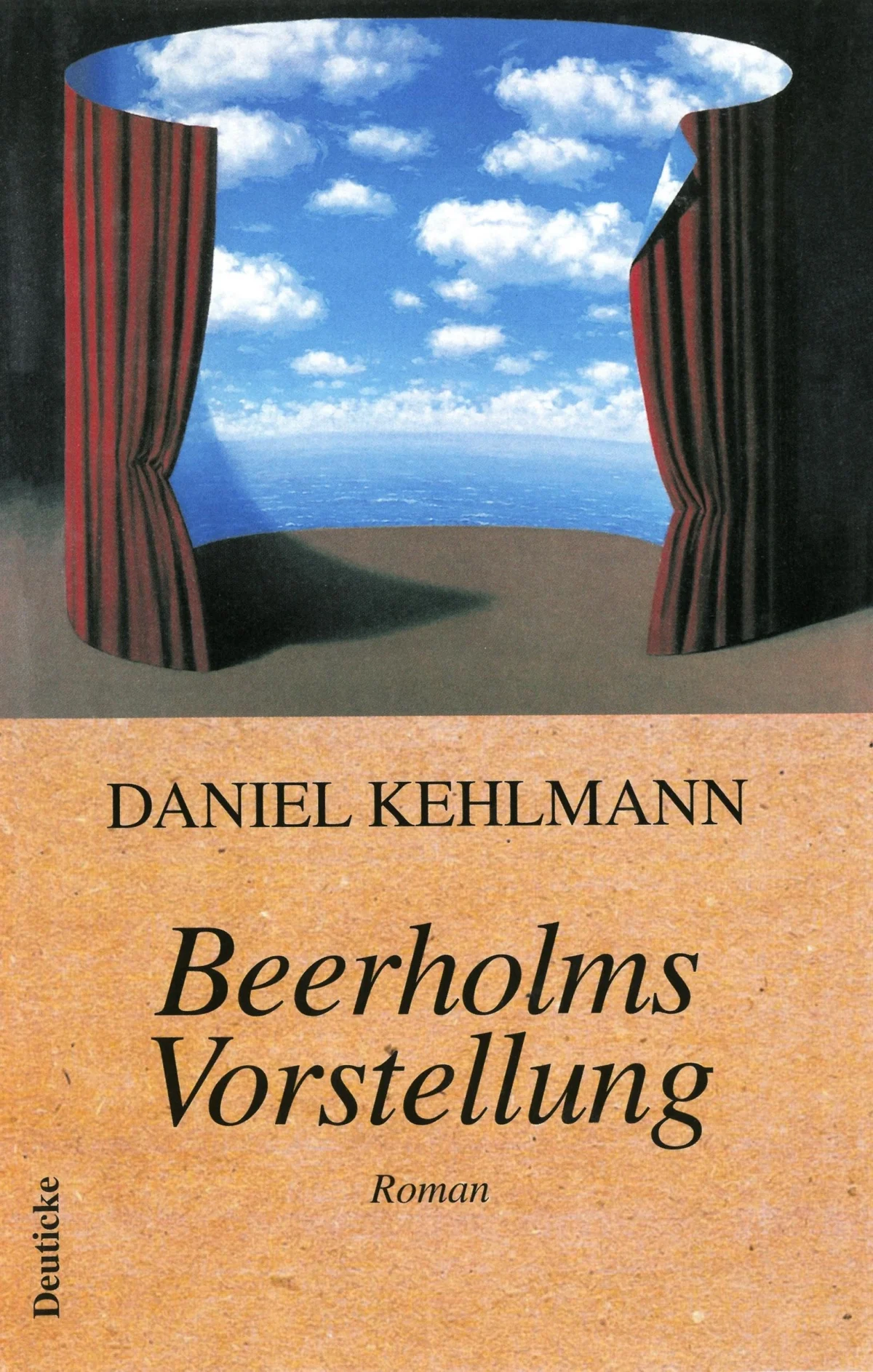Arthur Beerholm schreibt seine Biographie. Er beginnt in der Tradition eines Tristram Shandy zwar nicht bei pränatalen Erlebnissen, sondern läßt sein Gedächtnis erst kurz nach der Geburt einsetzen. In einem Roman, der den Begriff „Vorstellung“ im Titel führt, scheint eben alles möglich.
Der Ich-Erzähler wird sofort von seiner Mutter zur Adoption freigegeben, findet reiche Zieheltern, muß beobachten, wie seine Adoptivmutter vom Blitz erschlagen wird, landet in einem Internat, wird von der zweiten Frau seines Adoptivvaters um sein mögliches Erbe gebracht, beginnt ein Theologiestudium und scheitert daran. Denn seit er als Schüler entdeckt hat, wie man Kartentricks vorführt, scheint er darin zunächst seinen künftigen Beruf gefunden zu haben. Doch Beerholms erste Vorstellung in der Schule wird ein Mißerfolg. Wie er es dennoch schafft, ein anerkannter Vertreter seiner Zunft zu werden, erscheint allzu kühl erzählt.
Die Sterilität, die diesem Romanerstling anhaftet, kann auch durch mystische Vorgänge nicht unterbrochen werden. Selbst dann nicht, wenn sich der Erzähler am Ende vom Fernsehturm stürzt, nachdem er auch seine Laufbahn als Magier während einer Vorstellung plötzlich abgebrochen hat. Oder gaukelt er seinen Lesern selbst damit etwas vor, und bleibt alles eben nur Vorstellung?
Gleich, wie ausgeklügelt das Spiel mit diesem Heteronym auch betrieben wird, gleich, wie weit der Autor darin geht – der Text bleibt, was er ist: eine kühle Erzählung, die den Anspruch auf Perfektion zwar erhebt, eines allerdings nie wirklich anzustreben scheint, nämlich mehr als das zu sein.