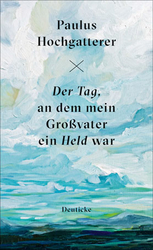Auf einem Hof in Niederösterreich kreuzen sich die Schicksale von Einheimischen, Flüchtlingen und deutschen Soldaten. Die „ausgebombte“ 13-jährige Nelly, ein verwaistes Flüchtlingsmädchen aus dem Donauschwäbischen, hat bei der Bauernfamilie Unterschlupf gefunden. Den Bauern und die Bäuerin nennt sie zutraulich „Großvater“ und „Großmutter“. Nelly hat ein feines Gespür für die Kräfte von Anziehung und Abstoßung auf dem Hof. Sie merkt, dass die Bauerstochter Annemarie den jungen Fremden mit dem komischen Akzent mag, der eines Tages auftaucht. Aber sie spürt auch, dass der Fremde in Gefahr ist und behauptet deshalb, er wäre ebenfalls ein Donauschwabe. Auch mit Laurenz, dem Bruder des Bauern, teilt sie ein Geheimnis. Laurenz hat einen Brief an das Bauernpaar unterschlagen, in dem ihnen der Tod ihres Sohnes „für Führer und Vaterland“ mitgeteilt wird.
Hochgatterer, von Beruf Kinder- und Jugendpsychiater, gelingt es formidabel, Nellys Eigenarten – eine freundliche Mischung aus kindlicher Sensationsgier, Naivität, erwachendem sexuellen Interesse und originellem Blick – zu zeichnen. Das Mädchen liebt die blutrünstigen Märtyrergeschichten der Bäuerin. Ihre Bewunderung gilt einer Mitschülerin, die „so schön strickt, dass man meint, die Sachen kommen aus der Fabrik“. Sie liebt es, vor dem Hutgeschäft zu stehen und die attraktive junge Verkäuferin zu beobachten, wenn sie – wie ein Torso von de Chirico – als „Isoldenoberkörper“ horizontal durch den Raum schwebt, als ob ihr Unterkörper sich irgendwo anders befände. Heimlich schwärmt Nelly für Annemarie, mit der sie sich ein Bett teilt – sehr zu deren Verdruss.
Von den eigentlichen Kriegshandlungen bekommt man auf dem Hof erst einmal nichts mit – abgesehen von den alliierten Kampfflugzeugen, die über den Wäldern zu den Städten fliegen. Dann wird der Bahnhof des nahegelegenen Städtchens bombardiert. Auf dem Hof treffen drei versprengte deutsche Soldaten ein, die sich in den besten Zimmern einquartieren und für den Festtagsschmaus am Karfreitag (!) ein Schwein mit Knödeln verlangen. Als der Bauer sich weigert zu schlachten, geht einer der Soldaten in den Stall und erschießt ein Tier. Noch brenzliger wird die Situation, als die Soldaten anfangen, den jungen Fremden zu verhören – der, wie sich herausstellt, Michail, ein Kunststudent aus Minsk und geflüchteter Kriegsgefangener ist.
In den Text sind mehrere Binnenerzählungen eingeflochten, die nicht aus Nellys Perspektive, sondern in der dritten Person erzählt werden. Sie lassen jeweils den größten Zweifel an ihrem Ausgang zurück. Ist das Kind, das am Fronleichnamszug teilnehmen wollte, wirklich im Mühlbach ertrunken? Wurde der amerikanische Airforce-Offizier, der sich per Schleudersitz aus seinem Flugzeug katapultierte, wirklich vom Mob erhängt? Und in der „Geschichte vom nicht erschossenen Suprematisten“: Wird Michail, der Kunststudent, umgebracht oder gerettet? Es stellt sich heraus, dass er, der in Deutschland für Görings Raubkunstsammlung arbeiten musste, sich bei einem Kunsttransport hatte einschließen lassen und so nach Österreich gelangte. Es wird angedeutet, dass Franz Marcs verschollenes Gemälde „Der Turm der blauen Pferde“ in seinem Besitz ist.
Gegen Ende wird Michail von den drei Soldaten in die Mitte genommen und soll zur Hinrichtung geführt werden. Da tritt ihnen der Bauer, Nellys „Großvater“, in den Weg und sagt: „Schämen Sie sich nicht?“. Was dann genau passiert, bleibt letztlich unklar. Erschlägt der Bauer den deutschen Offizier mit der Schaufel oder hebt er ein Grab aus für den Kriegsgefangenen? Die beiden Erzählstimmen des Buches können sich darüber nicht einigen. Paulus Hochgatterers schmale Erzählung wirft viele Fragen auf. Nicht nur die, was Heldentum eigentlich bedeutet, und wie die subjektive Wahrnehmung das spätere Narrativ beeinflusst. Sie stellt außerdem die Grenzen zwischen Fiktion und so genannter Wirklichkeit infrage. Weil sich die so genannte Wirklichkeit selbst zum großen Teil aus Erzählungen zusammensetzt, kann es nicht schaden, jeder Erzählung gegenüber skeptisch zu bleiben.