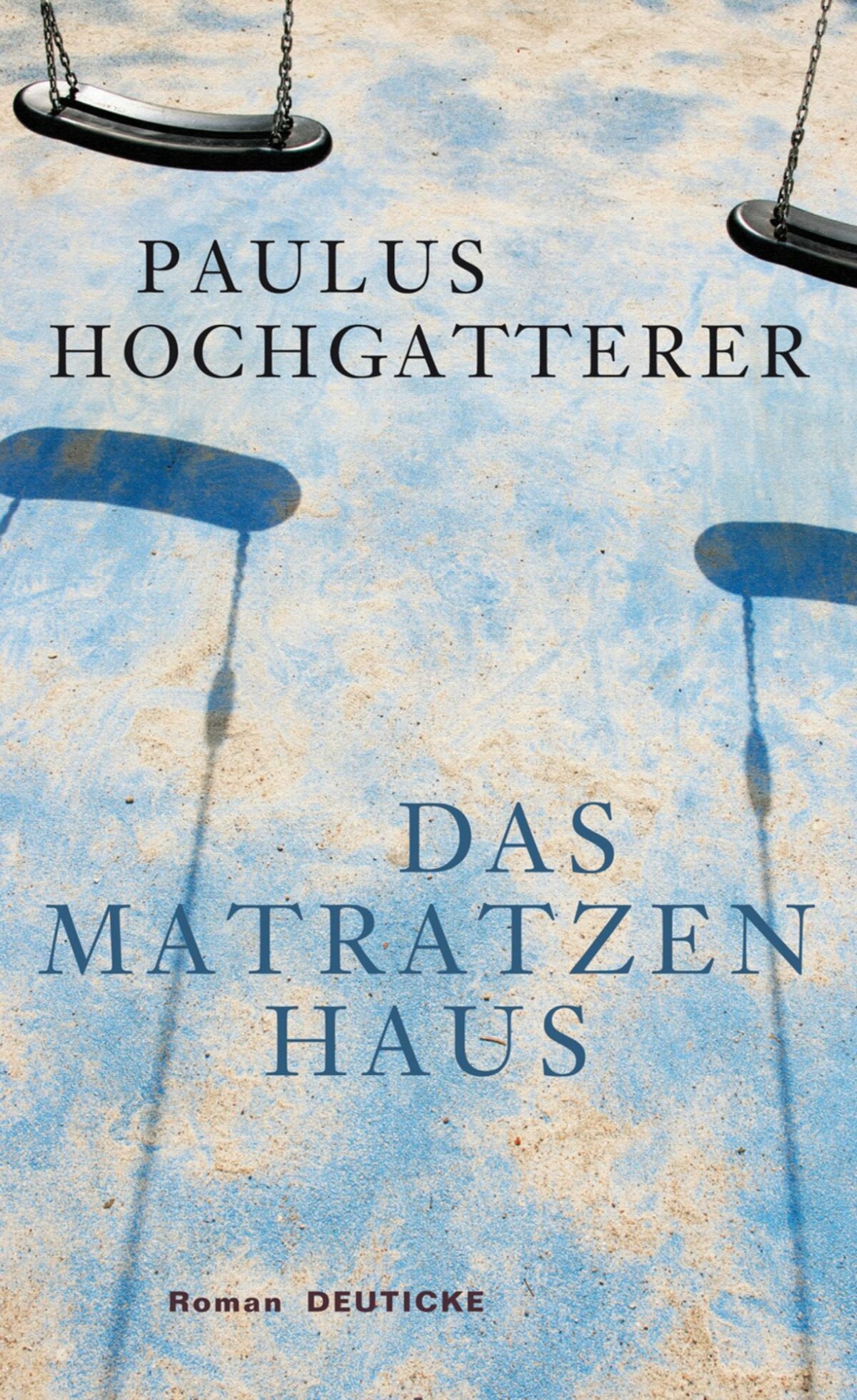Die bildmächtige Archaik dieser dem Roman vorangestellten Zeilen von John Dryden ist bezeichnend für das Urgefühl der Rache, die ausgelebt immer eine Demonstration und ein Zeichen an die Außenwelt ist. Oft in ritueller Form wird da ein vielleicht weit zurückliegender Schmerz inszeniert und dem Publikum kunstvoll vor Augen geführt. Rache ist eine aktive Tat, und zu dieser muss man sich erst einmal aufraffen.
Viele Menschen in Hochgatterers fiktiver Kleinstadt Furth am See haben Grund zur Rache. Böse Dinge geschahen und geschehen dort: Kinder verschwinden, werden geschlagen, verstoßen und missbraucht. Frauen ritzen sich die Pulsadern auf und verzweifelte Jugendliche versuchen sich zu erhängen.
Aus vier Perspektiven wird das Geschehen erzählt. Hochgatterer-Lesern bekannt ist der distanzierte, selbstkritische Psychiater Raffael Horn. Mit ihm zeichnet der Autor ein gewohnt witziges und pointiertes Portrait der ärztlichen Zunft und ihres angesichts des menschlichen Leides prävalenten Sarkasmus. Bekannt ist auch Ludwig Kovacs, der eigenbrötlerische Leiter der Further Kriminalpolizei. Er soll das mysteriöse Geschehen vor Ort untersuchen.
Die Geschichten um diese beiden Männer werden in der dritten Person und in der Vergangenheit erzählt. Trotzdem geben die beiden anhand ihres reflexiven Charakters und gewitzten Analysevermögens viel von sich und ihrer Welt preis. Wie nebenbei erfährt der Leser zum Beispiel von den charakterlichen Merkmalen männlicher Missbrauchstäter: „Eine Mischung aus Selbstverliebtheit und Schmierigkeit, eine ausgesprochene Tendenz zum vorauseilenden Angriff plus die Reaktionsbildung als dynamisches Grundprinzip: Mit dem, was dir droht, bedrohe die anderen; mit dem Richter zum Beispiel oder mit der Polizei.“ In diesem Sinn ist die Lektüre lehrhaft und aufklärerisch.
Eine weitere Erzählstimme gehört einer jungen Volksschullehrerin, die mit einem labilen Benediktinerpater liiert ist. Selbst Opfer männlicher Gewalttaten, steht sie den gefährdeten Kindern emotional nahe und spielt bei der Auflösung des Verbrechens eine entscheidende Rolle. Diese Lehrerinnen-Stimme ist Hochgatterer am wenigsten gelungen. Obwohl man ihre in der Gegenwart erzählten Passagen gerne liest, tritt hier Hochgatterers Eigenart hervor, etwas undifferenziert alle handelnden Personen mit Witz und Schlagfertigkeit auszustatten – selbst wenn sie diesen Menschen nicht unbedingt zuzutrauen sind.
Beeindruckend die vierte Erzählstimme: ein halbwüchsiges Mädchen mit indischem Adoptionshintergrund. Das einleitende Kapitel „Wie es gewesen sein muss“ schildert in atemberaubend verdichteter Weise den Verkauf eines armen indischen Kindes an westliche Kunden. Dieses Kind – oder ein Kind mit ähnlicher Biographie – landet im so genannten Matratzenhaus in Furth am See, wo es zum Opfer eines international operierenden Kinderpornorings wird.
Es verschlägt einem die Sprache, wie Hochgatterer das Leben und Überleben eines solcherart missbrauchten Kindes erzählt: Unmittelbar und ungefiltert spricht die Halbwüchsige mit dem vielklingenden Namen „Fanni“ (Englisch funny, fanny) in der Ich-Form zum Leser. Einzelheiten zum Missbrauch selbst erfährt man nicht, aber man sieht – was zumindest ebenso erschüttert –, welche Überlebensstrategien nötig werden, um gegen die erwachsenen Täter anzukommen. „Das Einzige, was wirklich zählt, ist die Augen offen zu halten“, belehrt Fanni ihre Adoptivschwester Switi. Fanni entwickelt Ticks um Fluchtwege, erfindet Befreiungsgeschichten um exotische Tiere und holt sich aus dem Internet das Wissen zum finalen Racheschlag.
Denn Wissen ist Macht. Macht, Ohnmacht und Ermächtigung – diese Trias gesellt sich zum Motivgeflecht um Rache und Schmerz. Geschlagene Väter, die ihre Kinder schlagen, ohnmächtige Kinder, die in einem exakt geplanten Rachefeldzug ihre Opferrolle transformieren. Dass Hochgatterer dies alles in einer österreichischen Kleinstadt ansiedelt, hat ihm zufolge damit zu tun, dass dort die Fallhöhe zwischen oberflächlicher Idylle und untergründiger Grausamkeit besonders hoch ist. Außerdem ist die Kleinstadt ein überschaubares Pflaster für das effektvolle Zusammentreffen der vielen Figuren, die Hochgatterer anhand seiner brillanten Dialoge lebendig werden lässt. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis dieser dialogstarke Roman verfilmt wird.
Unüberschaubar ist und bleibt die Welt, und mit seiner erzählperspektivischen Zersplittertheit gibt der Roman das gut wieder. Denn auch wenn sich die Perspektiven untereinander erhellen, bleibt dem Leser bis zum Schluss der beruhigende Durchblick verwehrt. Im Verbund mit Hochgatterers „Cliffhanger-Technik“, wo die Erzählstränge an den entscheidenden Stellen abbrechen, erzeugt das einen Sog, dem man sich kaum entziehen kann.
Dinge und Entwicklungen sind heute nicht mehr an einen Ort gebunden. Nicht zuletzt beweisen das die Vorgänge um den international operierenden Kinderpornoring. Es ist wie in Alejandro González Iñárritus Film „Babel“: Dort reist ein Gewehr um die Welt; hier reist eine Kindersex-DVD über die Grenzen von Furth. Hochgatterer eröffnet mit dem Blick auf die Kleinstadt einen Blick weit darüber hinaus, bis ans indische Meer, wo der Erzählung nach die Pelikane wohnen, die bedrohte Kinder in ihren Kehlsäcken forttragen.
Kritisch angemerkt sei der ärgerliche Einband des Buches: zwei verwaiste, leer schwingende Schaukeln vor Schäfchenwolkenhimmel – ein zur Plattitüde verkommenes Bild für Kindesmissbrauch, wie es in jedem schlechten Fernseh-Feature zu sehen ist. Hier hätte sich der Deuticke Verlag an Hochgatterers fantasiereichere, aber konkrete Bildproduktion halten sollen.