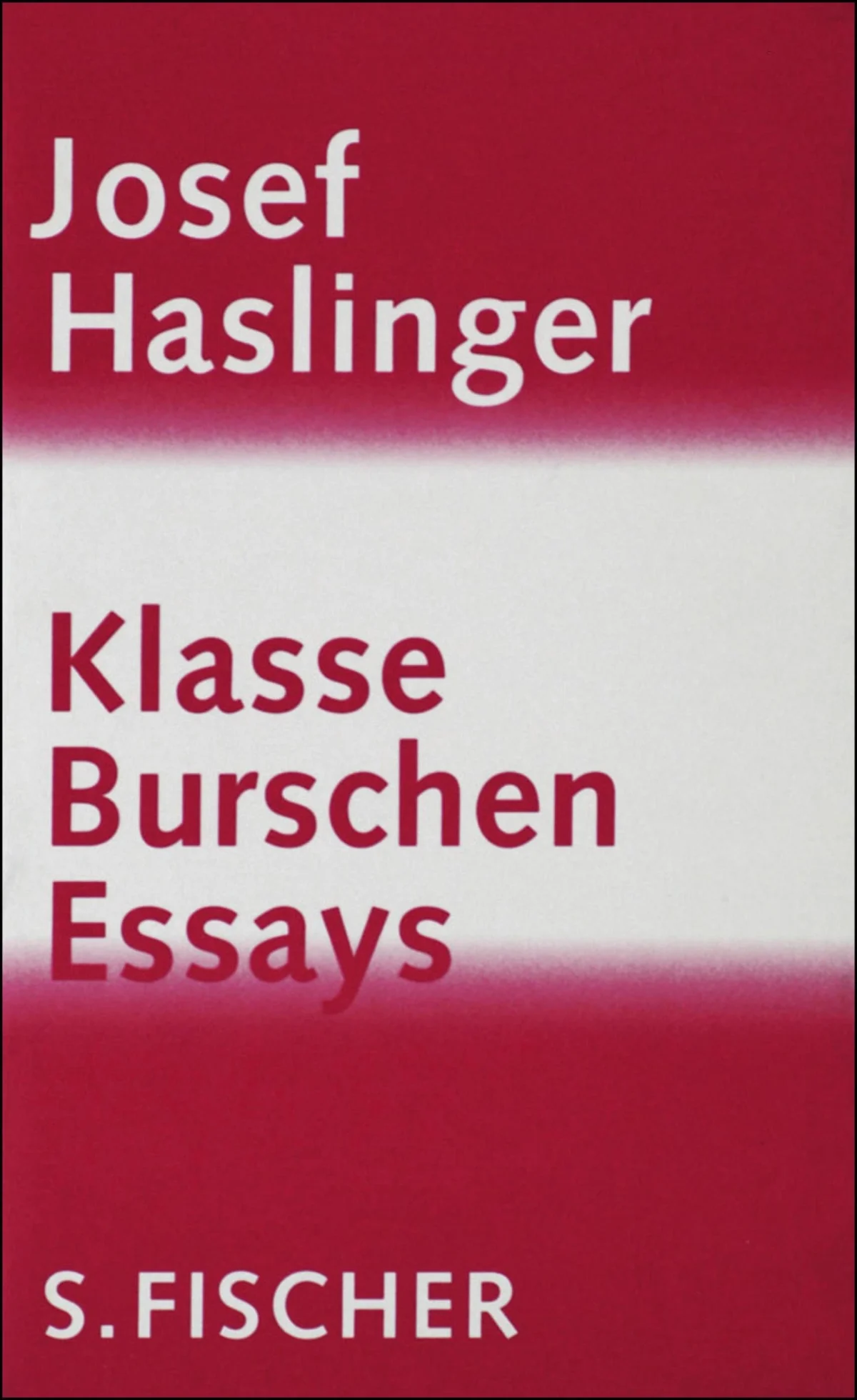Der Essayband beinhaltet Beiträge für Zeitungen und Vorträge aus den Jahren 1993 bis 2001, oft liegt ihnen ein konkreter Anlass zugrunde. So schreibt Haslinger seinen titelgebenden Artikel Klasse Burschen in der Süddeutschen, nachdem er im Fernsehen die Wiener Symphoniker im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen Beethovens „Ode an die Freude“ anstimmen hörte. „Hätten sie doch wenigstens Mozarts Requiem gespielt.“ Oder doch nicht. Vielleicht wäre ein Requiem noch verlogener gewesen als Beethovens Neunte. Aus der Stätte der Trauer und Scham war die makabre Kulisse für ein Konzert geworden. „Mauthausen ist nicht länger der Ort des Schweigens, des stillen Gedenkens an die Ermordung von Menschen, an hilflose Schreie und an die Entsorgung der Leichen durch den Kamin. Mauthausen ist laut geworden. Mauthausen dröhnt über das Donautal und durch die Fernsehkanäle.“
In seinem letzten ausführlichen Beitrag „Ausfahrt Weimar gesperrt“, einem Vortrag über die Zukunft des Schreibens, beantwortet Josef Haslinger, warum es ihm ein Anliegen ist, Stellung zu beziehen, warum er sich nicht in den Elfenbeinturm des unpolitischen aber genialischen, des zutiefst zynischen oder ästhetisch-weltfremden Autors zurückzieht. Fast romantisch behauptet er die Rolle des Schriftstellers als moralische Instanz gegen die ausufernden Informationsfluten des quellenlosen, anonymen World Wide Web. Auch wenn der Schriftsteller an gesellschaftlicher Relevanz verloren hat, behauptet Haslinger, gelingt es ihm immer noch Kraft seiner Bücher und seines Zugangs zu den Medien Stellung zu beziehen. Er wird – noch – gehört und Josef Haslinger stellt sich ganz altmodisch und ganz bewußt in die Tradition christlich-abendländischen Denkens. „Was ich denke ist bloß, dass man um bestimmte ethische Prinzipien nicht herumkommt“, erklärte er vor kurzem in einem Interview.
Die „Klassen Burschen“ legen ein beredtes Zeugnis ab. Josef Haslinger schreibt über Schwarz/Blau und die jüngste österreichische Geschichte, über versteckten und offenen Rassismus, über die Kriege im ehemaligen Jugoslawien, die USA und den Golfkrieg, über George W. Bush, Gentechnologie und die Zukunft des Schreibens. Seine Artikel appellieren an Toleranz und Verständnis. „Kein Krieg hat den Menschen bisher zum Frieden erzogen“, antwortet er den Kriegsmaschinerien, die auffahren, um Konflikte zu lösen, wie verständlich auch immer die Motive, denn Krieg führe nicht zu Sehnsucht nach Frieden, Krieg erzeuge Krieg.
In seinem Artikel „Im Bett von Jörg Haider“ in der Süddeutschen (März 2000) beschäftigt sich Josef Haslinger mit endlosem Schweigen, Vergessen und Verdrängen. Warum, fragt er, warum wehrte sich Österreich so verbissen gegen die Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit? Warum hielt sich die bequeme Nachkriegslüge, Österreich als eines der ersten Opfer Nazideutschlands zu entschuldigen, in den Diplomatengesichtern noch in Zeiten, als in anderen Ländern, und nicht nur in Deutschland, längst ein schmerzhafter und unwiderruflicher Diskussionsprozess begonnen hatte?
Nicht nur die Kollaboration mit dem Nationalsozialismus und die mehr als willige Beteilung am Genozid wurden in unheilvollem Schweigen erstickt. Haslinger kommt zum Schluss, dass in Österreich ein zweites starkes Motiv für das willige Vergessen ausschlaggebend war, und zwar der Bürgerkrieg 1934: „Und nun muss man sich Folgendes vorstellen: 1945 wurde das Land von den Befreiern zwei Parteien anvertraut, die bei ihrem letzten offiziellen Zusammentreffen, elf Jahre zuvor, aufeinander geschossen hatten. Die Führer dieser Parteien waren sich über zwei Dinge im Klaren. Erstens: Wir dürfen nicht über den Nationalsozialismus reden, denn sonst müssten wir auch über den Bürgerkrieg reden. Und das wäre für die neue Republik verhängnisvoll. Zweitens: Wir dürfen die Parteikader, in deren Knochen noch der Bürgerkrieg saß, nicht öffentlich aufeinander loslassen.“
Das mag keine Entschuldigung sein, Haslinger will auch gar nicht entschuldigen, sein Essay über Österreichs blinde Flecken spürt jedoch Ursachen nach und lässt es nicht bei mittlerweile salonfähigen, meist kitschig billigen Austria-maxima-culpa-Gesten bewenden.
Josef Haslinger Essays zeichnen sich grundsätzlich durch ihre Verständlichkeit und Klarheit aus. Ihr Verfasser erfindet vielleicht das Rad nicht neu, die Artikel bemühen sich nicht um Originalität oder spektakuläre Gesten, ihnen fehlt sogar der typisch österreichische Betroffenheitsgestus.
Es handelt sich, nicht mehr und nicht weniger, um kluge und sensible Kommentare zum Zeitgeschehen, scharf manchmal, gelegentlich launig und vor allem unbestechlich. Sie erfüllen, was Haslinger in einem seiner Artikel fordert: „Wenn ich persönlich eine Erwartung an die Intellektuellen setze, dann zumindest die, immer dann, wenn ihnen das Nötige abverlangt wird, unnötige Einwände zu formulieren.“