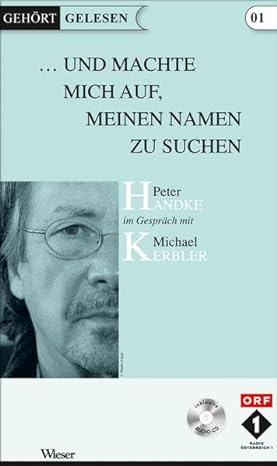Beim Gespräch mit Michael Kerbler lässt sich angesichts der wortgenauen Wiedergabe nichts derartiges behaupten. Das Interview ist ungekürzt und ohne „Transkription“ ins Lesbare gedruckt. Ein Beispiel: „Bah, es gibt sicher, gibt sicher – ich mein, ich hab vor drei, vier Wochen mein erstes veröffentlichtes Buch oder mein erstes langes Buch gelesen, „Die Hornissen“, und da ist im Grund alles drin, was immer noch weiter-, weiterweht oder -würgt oder -wurschtelt in mir: der Traum, die Brudersuche, das Blindsein – das Verlorengehen, das Vermisstsein, das Warten auf den Vermissten und so weiter.“ (S.12) Zwar garantiert dieses Verfahren den Ausschluss falscher Zitate, doch erkennt man schnell, dass das Ö1-Motto „GEHÖRT GEHÖRT“ auch hier zutrifft. Die beiliegende CD verlebendigt den holprigen Lesestoff und gespannt verfolgt man Handke bei der Gedanken- und Wortfindung, lernt ihn über Stimme und Aussprache kennen und spürt die mitschwingende Emotion. Das schmale Buch, das im Format an DVD-Editionen erinnert, ist dabei praktische Nachlesehilfe und also ist die Idee des Ganzen lobenswert.
Der Gesprächspartner oder das „Gegenüber“ (Handke: „ein Gegenüber ist ja wirklich ein schönes Wort für Mensch“, S.60) von Peter Handke, Michael Kerbler, seit 2003 Leiter der Ö 1-Sendereihe „Im Gespräch“, beherrscht eine sanfte und doch insistierende Gesprächsführung. Da wird nachgefragt, wo es wichtig ist, und zügig weitergegangen zum nächsten Thema ohne sprunghaft zu werden. Insgesamt hält er eine Linie ein, die mit Fragen über die frühe Jugend und Familie Handkes beginnt und dann über Heimat, Kärnten und Österreich („deklarierte Zweisprachigkeit in den Ortstafeln – es gibt nichts Besseres für den Fremdenverkehr“, S.18), über die Sprache und das Slowenische („Die geschriebene, gedichtete Sprache erhält die Sprache. Die journalistische Sprache erhält die eigene Sprache nicht.“, S.20), das Reisen und insbesondere das Wandern im slowenischen Karst hin zu Jugoslawien und Europa führt. Hier macht Kerbler einen Anlauf zum derzeit heißen Handke Thema: „Ich hab versucht, nachzuvollziehen oder zu verstehen, was für Sie das Besondere an, ja, ich sag jetzt mal an Jugoslawien war: Ein Modell für Europa?“ Handke: „Das war für mich das Europa …abgezogen natürlich die totalitären Elemente …wie man sich das hätte vorstellen können, ein Europa.“ (S.30). Kerbler weicht ab, befragt Handke zur Langsamkeit („ich mach gern Umwege, weil, mein ganzer Ehrgeiz ist als Mensch: Zeit zu haben.“, S.34), dann zum Theater („Ich bin ein Schriftsteller, also ich hab keine Ideologie, ich habe nur Probleme.“ S.40), zu Ironie („Ich hasse Ironie.“, S.44) und kehrt dann wieder zum Serbien-Thema zurück.
Handke: „Ich bin dankbar für das, was ich machen konnte als Schriftsteller“ und „Was ich geschrieben habe – ich setze oder lege die Betonung auf das Geschriebene, die Winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina …darauf bin ich stolz, da bin ich nicht dankbar“ (S. 52) Dies erscheint mir als Widerspruch zu dem, was er am Anfang des Gespräches behauptet (S.20), nämlich dass nur die dichterische Sprache – im Gegensatz zur journalistischen Sprache – die Sprache erhält und sinngemäß somit die wertvollere ist. „Eines der Geheimnisse des Schreibens oder des epischen Schreibens oder überhaupt des Schreibens ist ja auch die Verwandlung.“ (S.58) In Eine winterliche Reise …“ (ursprünglich erschienen in der Süddeutschen Zeitung 1996) findet jedoch keine Verwandlung statt, eher ist es eine Abrechnung mit jenen Journalisten, die die Situation auf dem Balkan seiner Meinung nach falsch darstellen. Seltsam mutet dieser Stolz auf eine Sprache an, die er selbst als minderwertig ansieht. Michael Kerbler kreist Peter Handke mit thematisch übergeordneten Fragen ein (Woran ist die Lebensleistung eines Schriftstellers zu messen? Kann nur ein guter Mensch ein guter Schriftsteller werden? Was für ein Geschichtsbild entwirft er betreffend Milosevic?), so lange bis der spürbar gereizte Handke ihn fragt: „…was wollen Sie jetzt damit? Wollen Sie da irgendein – Sie werden mich nicht dazu bringen, dass ich in einen Streit gerate.“ (S.64) und Kerbler beendet das Gespräch mit der Abschlussfrage, was bliebe, wenn man Peter Handke den Bleistift wegnähme …(„das Schreiben könnte ich sausen lassen“ S.65).
Leider fehlt ein genaues Datum des Gespräches (Dauer: 72 Minuten beziehungsweise 66 Seiten), aber es gibt viele Hinweise, dass Handke zu dieser Zeit an seiner Erzählung „Die Morawische Nacht“ arbeitete. Insofern ist das Interview eine empfehlenswerte Ergänzung zur Buchlektüre und insgesamt hat man die Möglichkeit, sich selbst ein Bild über den umstrittenen Autor zu machen. Man darf neugierig auf die nächsten Folgen dieser Serie sein, die sich durchaus als Sammlerstücke für interessierte LeserInnen eignen könnten.