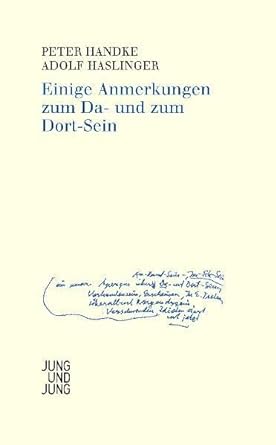Nicht nur sein Werk (als letztes großes Epos die „Niemandsbucht“, 1994), auch sein Alltag – mit einem sehr präzisen Tagesablauf – widmet sich dieser Aufgabe: Da ist die Spracharbeit als Schöpfungsakt und Existenzbeweis der ‚Sachen‘, das Gehen in der Natur (vorzugsweise in der Peripherie von Städten), das Schauen und Wahrnehmen des Unscheinbaren als Nachvollzug der Dinghaftigkeit der Welt. Er, Handke, schrieb Jochen Jung, flaniere nicht. Adolf Haslinger zitiert diese Sätze in seiner laudatio: „Er wandert auch nicht, und vor allem geht er nicht spazieren. Er geht“.
Gehen aber heißt: einem Ort treu bleiben und ihn durchstreifend verlassen, ihn kennenlernen und ihn als Fremdes entdecken, sich einlassen und dennoch ein immer wieder neues Wahrnehmungsgefühl entwickeln. Handke hat dies in seine Werke eingeschrieben, in die langsame, offene Form seiner Sätze, in die Begegnung mit dem Unscheinbaren, dem der Erzähler sich hingibt und in das er sich verstrickt (dem er den Schein, den Glanz des So-Seins und Da-Seins zu verleihen wusste), und in dem Blick auf das Einzelne, Kleine, das am Rand liegt und wie alles Alltägliche dem gewohnten Blick zu entgehen droht. Handkes Gegenentwurf: Er geht. „Er ist nie Tourist, stets Botaniker, Zoologe, Käfer- und Schmetterlings-Experte und vor allem Pilzforscher“, sagt Adolf Haslinger, verständiger Laudator, Freund und Weggefährte seit den Salzburger Jahren. Handke also ein, wie er sich selbst nennt, „Ortsschriftsteller“, der weiß, dass „die Räume, die Begrenzungen […] die Erlebnisse erst hervorbringen“.
Und nicht nur den Räumen und Landschaften verhilft dieser Wanderer (Wandern im alten Sinn einer peregrinatio) zur Existenz, nicht nur den Orten (aus gegebenem Anlass ist hier Salzburg zu nennen, wo er in den Jahren 1979-1987 gelebt hat). Handke erinnert auch an jenes Erlebnis, als er, einsam ausschreitend auf den Stiegl-Gleisen, in Maxglan einen jungen Menschen wahrnahm, der aus der Hintertür einer Garküche heraustrat, in welcher er seiner Arbeit als Koch nachging. Und Handke beschreibt, wie dessen Gesicht mit einem Mal die Freude zeigte, gesehen zu werden, durch den Blick des anderen in seinem alltäglichen Werk gewürdigt zu sein. Eine jener Erfahrungen aus dem „Abseits“, die Handke uns übermittelt und damit zugleich der Zeit entzogen hat. Erfahrungen, wie sie die Literatur zu erschreiben (nicht zu erfinden) hat: eine Form der Genauigkeit, der Wiederherstellung von Würde, des Sehens und Schauens. Literatur – sie ist unser Gedächtnis. Ohne sie wären wir ärmer, verlören den Begriff von einem menschenwürdigen Leben.
Literatur aber ist Memoria, wie die Namen. Zwei davon nennt Handke in seiner Rede: Zenedek Adamec und Roman Mal. Und weil Literatur Zusammenhänge schafft (über alle Fährnisse hinweg, da dies auch immer heißt, Sinn zu schaffen in einer Welt, die womöglich nur absurd, chaotisch ist), ist auch dieser Teil von Handkes Rede – wie sein ganzes Oeuvre – ein gegenseitiges In-Beziehung-Setzen und Verweisen; sei es auf seine Rolle als poète engagé, der sich in Zeitläufe einmischt (was ihm viel Schelte einbrachte), sei es als ein Erzähler, der frühere Figuren mit neuen Werken verknüpft, Passagen anderweitig ‚zitiert‘ oder sich als Übersetzer zu vorhandenen Texten neu positioniert.
Das alles sind nichts weniger als fortgesetzte Akte der Aufklärung in einer „von Informationen verstellten Welt“ (so Adolf Haslinger), Gegenentwürfe zum Verknöcherten, Berechneten, Verfügbaren. „Ich bin überzeugt von der begriffsauflösenden und damit zukunftsmächtigen Kraft des poetischen Denkens“, schrieb Handke einmal. Vielleicht darf man auch sagen, des begriffsauslösenden Denkens; denn, Handkes Suchbewegungen haben uns immer auch das Sehen, Begreifen gelehrt (was nicht weniger heißt, als eine klarere Begegnung mit der Gesellschaft, mit sich selbst, eine Möglichkeit, dem drohenden Weltverlust durch Anschauung Weltgewinnung abzutrotzen).
Freilich braucht es Geduld, um Handke auf diesem Weg zu folgen: Nicht nur in dem Anspruch an den Leser, sich auf sein mäandrierendes Erzählen einzulassen, ihm auf der Suche nach dem (fast) unaussprechbar Individuellen zu folgen. Geduld braucht es auch gegenüber dem Menschen und Schriftsteller: Wenn Handke am Ende seiner Rede, die, wie er einräumt, nur aus Aperçus bestehen wollte, welche er sich – ein Auszug des handschriftlichen Entwurfs ziert das Titelbild – am 18.6.2003, kurz vor dem Festakt notierte, und die dann in der Tat nicht mehr als ein paar zerstreute Anmerkungen zu seiner Salzburger Zeit, zum Krieg im Irak (der in einem prekären Sinn für Handke gar nicht ‚ist‘) und den von der Weltöffentlichkeit kaum wahrgenommenen Prager Protesten, zum literarischen Kanon und zur seit Jahrtausenden stattfindenden großen „Verschwindens- oder Erscheinungsgeschichte“ sind (weshalb er ausführlich die Schlusspassagen seiner „Ödipus in Kolonos“-Übersetzung zitiert), dann haben wir nicht nur die Stimme eines zornigen Zeitgenossen gehört, der sich um das Subjektive seiner Meinung nicht zu kümmern scheint, sondern auch einen frischgebackenen Ehrendoktor vernommen, der die Huldigung seiner Person und seines Werks als Freibrief versteht, Ressentiments zu befestigen. Das ist schade, zerstört es doch einen Festakt, der zu einem Symposion hätte werden können. Denn nicht nur die Dinge, die der Autor liebt, haben ihre Würde. Und nicht nur jene Zurückgezogenen, die Handkes Lebensentwurf teilen (doch unzweifelhaft ein Privileg), sind die ‚guten‘ „Idioten“ (Sich-Selbst-Seiende, zu denen er sich bekennt), sondern auch die Anwesenden haben ein Recht, mit dem empathetischen Blick der Liebe (denn was anderes sollte Literatur lehren) wahrgenommen zu werden. Wer sich aber in die Gesellschaft von ‚Idioten‘ begibt, freiwillig und ohne Not, sollte nicht andere dafür schelten, dass er noch einmal – „das letzte Mal“ – öffentlich auftrat. Es geht viel einfacher: wegbleiben.