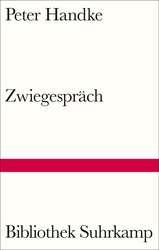Dies war die Erzähl-, besser: die Nichterzähl-Welt des Schweizers Gerhard Meier (1917-2008). In seinen drei Hauptbüchern, der handlungs- wie abenteuerfreien Baur-und-Bindschädler-Trilogie, wird viel geredet, fast unablässig. Aber in ruhiger Gemessenheit. Fast, als würden die Dinge auch, vielleicht erst recht ohne Reden vonstattengehen. Nur in Gespräch und Reflexion nämlich lassen sich, heißt es einmal bei Meier, die „Fäden in den Griff bekommen, die einen verbinden mit dem Verflossenen, Dahingegangenen, Unwiederbringlichen“.
Nun kennt Peter Handke die Bücher Meiers, der seine zwei letzten Veröffentlichungen Handkes Stamm-Verlagshaus Suhrkamp anvertraute. Handke gehörte der Jury an, die dem Innerschweizer 1983 den Petrarca-Preis zusprach. Baur und Bindschädler gehen und reden während des Gehens, am Ende sinnt der Lebende über das Sterben des Anderen nach. Wie ein Schweizer Journalist bemerkte, setzte Meier die Wiederholung als Kunstmittel ein. Diese Kunst der Wiederholung machte aus dem fiktiven Ort Amrain, Meiers Heimatgemeinde Niederbipp nachgeformt, einen transzendenten Ort. Und aus Amrains Einwohnern wurden Weltenbürger.
Schlägt man Peter Handkes jüngsten, schmalen Band Zwiegespräch auf, der das Dialogische bereits im Titel trägt, findet man eine geisterhafte Widmung, die nahezu transzendent ist. Sie lautet: „für Otto Sander und Bruno Ganz“. Für die zwei Schauspieler also, beide mittlerweile verstorben, mit denen Handke mehr als gut bekannt war. Beide gespensterten anno 1987 in Wim Wenders‘ Film „Der Himmel über Berlin“ als Engel durch die damals noch geteilte deutsche Stadt. Das Drehbuch verfasste Wenders zusammen mit Peter Handke.
In Zwiegespräch reden zwei. Miteinander. Nebeneinander. Auch aneinander vorbei. Sie wiederholen sich hie und da. Oder der eine nimmt das Ende eines Erzählfadens auf, versucht, die Fäden in den Griff zu bekommen, die dem anderen entglitten sind. Es ist kunstvolles Versanden, rhetorische Anti-Rhetorik, da an vielen Stellen manieriert ungeschmeidig, es ist Erfinden wider das Erfinden, Erzählen übers Erzählen, das sich naivem Wortaufstellen und Satz-an-Satz-Reihen entzieht, auf magische Weise.
In dem 2006 veröffentlichten Briefwechsel mit Hermann Lenz, dem 1998 in München verstorbenen stillen Erzähler aus Schwaben, las man von Handke: „Die Kraft und die Mühe des ERFINDENS liegt in der Art, wie Sie [Lenz] sich aus sich selber herausbegeben und doch das Gleichgewicht mit sich bewahren, d. h., sich nicht lächerlich sehen, nicht nur als ’sauren‘ Schwaben, sondern als eine von allen Möglichkeiten unabgeschnittene Existenz; als eine Bewegung von Wahrheit in einer bestimmten Zeit erfährt man das als Leser, und das ist die rechte Literatur, und eine Wirkung nur der Literatur.“
Wie Handkes Langerzählung „Die morawische Nacht“ (2008) ist Zwiegespräch eine Prosa aus mäandrierenden, ineinander bis zum Splittern verschachtelten Sätzen und aus wechselnden Stimmen. Es ist eine Prosa mit mehrfach gebrochener Choreografie, auf der Stelle des Moments hin- und herspringend zwischen Alltagsbeobachtung und mémoire, Reflexion und Polemik, schwerem Pathos und leichtem Spiel, Evokation der Historie und vehementer Anklage der Geschichtslosigkeit der Nachgeborenen, zwischen Theaterabgesang und John Ford-Zitat.
Es ist in einem mündlichen Duktus gehalten, der, hat man filmische Dokumentationen über Handke gesehen oder Michael Kerblers ORF-Gespräch gehört, das 2007 der Klagenfurter Wieser Verlag als Hörbuch vertrieb, Handkes eigenem Sprechrhythmus ganz und gar entspricht.
Wieder geht es um Lärm und Stille, um das Leiden am Ungeist der Zeit und ein Über-die-Gegenwart-Hinwegfliegen. Es geht sinnlich um alle Sinne, um Hören, Lauschen, Schmecken. Wie es auch um den Tod geht, um Sterben, Vergehen, Auslöschen. Vor allem, diesmal zusätzlich alterskokett (Wortfindungsschwierigkeiten werden beklagt!), geht es um die Sprache. Am Ende des Gesprächs mit Kerbler sagte Handke: „Die deutsche Sprache ist eine herrliche Sprache. Teilnehmen und teilhaben, und dann wieder, wie der Camus sagt: wo ist das Gleichgewicht zwischen, wie er sagt auf Französisch, ’solitaire‘, das heißt einsam, und ’solidaire‘, solidarisch – einsam und gemeinsam. Kann man nicht ersetzen, das ist das ewige Problem. Das Alleinsein ist keine Lösung, und das dauernde Gemeinsam, das ist, glaub ich, noch verderblicher. Das ganze Geheimnis im Leben ist der Abstand – der Abstand und der Rhythmus, was man aus dem Abstand macht.“
Geheimnis und Abstand, Einsam/Gemeinsam, Rhythmus und das Leben Schreiben – die vielleicht entscheidenden poetologischen Pole des Nobelpreisträgers. Es scheint wahrhaftig ein einziges zusammenhängendes Buch zu sein, an dem Peter Handke seit fast sechzig Jahren schreibt, geschrieben hat. Auch für seinen neuesten Prosaband, neuerlich von Verlagsseite luxuriös, weil typografisch größer denn in der Reihe „Bibliothek Suhrkamp“ üblich gesetzt, ließe sich leicht eine Zusammenfassung aus Motiven und Titeln seiner Bücher montieren. Darin kämen Abwesenheit vor und Kindergeschichte, Langsame Heimkehr und Bildverlust, Stunde der wahren Empfindung, Versuch über den geglückten Tag und Gestern unterwegs. Wie heißt es in Zwiegespräch gleich zu Beginn: „Wieder wahr. Und recht so: Auf, spielen wir weiter die Narren.“