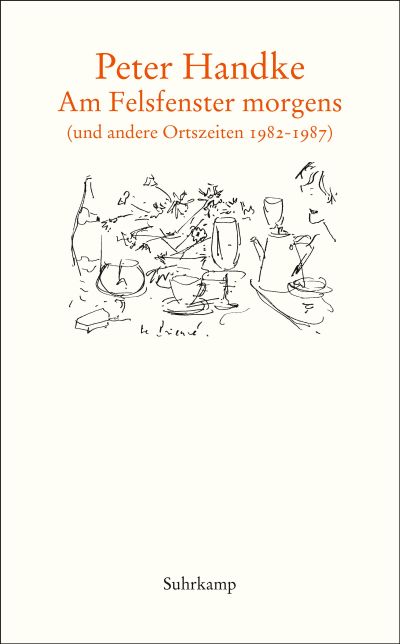Sein Salzburger Journal Am Felsfenster morgens, „Reflexe […] einer grundsätzlichen Bedachtsamkeit“, aus den Jahren „der Seßhaftigkeit und des Wohnens“ von 1982 bis 1987 endet mit dem Aufbruch zu einer Weltfahrt. Ihm voraus liegt die „Langsame Heimkehr“, jenes Werk, mit dem Handke sich wie nie zuvor „ausgesetzt“ hatte – ein kritischer Wendepunkt seines Schreibens, vom Absturz in die „Sprachlosigkeit“ bedroht und nach eigener Aussage mit dem Verlust des „Charismas“ bezahlt.
Auch wiederlesend kommt Handke darauf zurück: „In ‚Langsame Heimkehr‘ – ich lese mein Buch gerade in einem herrlichen Englisch, so still und dinghaft, wie es ein Englischschreibender wohl schwer schaffen kann – ist keine kalte, pompöse, sondern eine warme, süße Feierlichkeit. Die Erzählung lesend – wäre sie nicht übersetzt, hätte ich sie vielleicht nie mehr gelesen -, fühle ich starke Verpflichtung.“
Die Übersetzung – in diesem Fall von Ralph Manheim (auf den Handke später einen berührenden Nachruf geschrieben hat) – bekräftigt ein Wagnis, das in der Folge gelassener und freizügiger fortgesetzt und erneuert werden kann. So wie das eigene Werk durch die fremde Übersetzung an Eigentümlichkeit gewinnt, ist Handkes vielfältige Übersetzungsarbeit – zum Beispiel an den wunderbaren Romanen Emmanuel Boves – eine Form des Handwerks des Schreibens und des Lesens, das durch das Fremde zu sich kommt.
Unter den vielen Möglichkeiten, sich mit diesem Journal auseinanderzusetzen, ist das Lesen der Lektüre Handkes sicher eine der lohnendsten. Es ist eine Schule wider die Geläufigkeit. Der pejorative Sinn von „Wortklauben“ verkehrt sich wie von selbst in das Abenteuer der Aufmerksamkeit für Nuancen, Verknüpfungstechniken und Minimalsätze, die Handkes Ideal einer frei-setzenden und frei-denkenden Erzählung, die Zwischen-Räume herstellt und durchlässig bleibt, so konkret wie einleuchtend macht. Handkes Zitate aus der Weltliteratur, vom georgischen Epos des Mittelalters bis zum „Talmud“, von Francis Ponge bis zum japanischen Haiku und No-Spiel, von Franz Michael Felder bis Hugo von Hofmannsthal, sind nicht auf Verkündigungsssätze und Weisheiten aus. Sie beglaubigen und ermöglichen ein Sehen, das literarisch – mit Hilfe der alten Zeichen – eine neue Moderne (gegen die Spielsucht der Postmoderne und gegen die keinen Raum lassenden Beschreibungszwänge des Romans des 19. Jahrhunderts) zu begründen sucht.
Zur eigenen Verblüffung bekennt sich der einstige Sprachskeptiker nunmehr zu einem Sprachvertrauen, das sich allerdings listig dem (falschen) Beifall entzieht: „Niemand glaubt mehr an die Sprache; außer mir, der doch einst besonders sprachungläubig gewesen ist – auch den Ungläubigen spielte; Gleichgesinnte, bitte nicht melden“ (56). Zu vorschnellem Mißtrauen besteht kein Grund: Handkes Aufmerksamkeit für die Formeln und Schablonen der Alltags- , Wissenschafts- und, vor allem, der Zeitungssprache hat nicht nachgelassen. Monströse Exempel aus der österreichischen Wirklichkeit sind festgehalten, samt der Warnung, die kritischen Reflexe nicht in einer (geborgten) Pose erstarren zu lassen: „‚Wir wurden von einer Weisungslage überrollt‘, sagte der Beamte. (Aber nur kein Karl Kraus werden)“.
Die prinzipielle Verschiedenheit von Rede und Schrift schließt die Findekunst von Wörtern aus der Kindheit und der Gemeinsprache nicht aus: „folge der Gemeinsprache – aber verlaß dich nicht auf sie“. Das Nebenbei des Gesprochenen ist Teil einer Archäologie der Zeichen, mit denen sich das Gutheißen der Welt in der Schrift beglaubigen läßt.
Fündig wird der sprachforschende Schreiber vor allem an den Rändern der Stadt, bei der stotternden Schwermut der Gestrandeten, den Betrunkenen und der unroutinierten Erfahrung der Machtlosen. In diesem topographischen wie sozialen „terrain vague“ findet der Spezialist für den Ort auch die Schönheitsmomente, die in diesem Journal als haltbare und festgehaltene Gegenschrift zu dem „Geschnatter“ und dem dröhnenden Lachen der Bewohner des Heimatlandes übergeht in die „mythische Geographie“ des Karsts und Sloweniens.
Kein anderes Schreibvorhaben der Salzburger Jahre ist mit vergleichbarer Sorgfalt und Geduld mitbeschrieben wie „Die Wiederholung“: Von der Suche nach dem Entsprechungsverb für Naturdinge, vom Markieren der zeitlichen Übergänge („Zeitschwellen“) im Erzählen bis zum Entwurf des epischen Helden und dem Erzählen der Erzählung nimmt der Leser teil am Abenteuer dieses „Epos eines Heimatlosen“. Kein Wunder, daß es auch ein Wunschtext ist: „Wunsch, daß Österreich ein dunkles, schönes Land wäre“. Der spätere Zusammenprall mit Politik und Geschichte ist in seiner Wucht an der Anstrengung zu erkennen, mit der Handke eine „Gedächtniserforschung“ betreibt, die auf das Andere zur Historie aus ist. Geschichte erscheint in wiederkehrenden Notaten als nicht poesiefähig. Sie wird mitunter beschwörend ferngehalten und durch Anrufungen der Natur außer Kraft gesetzt. Das leitmotivische Francis Ponge-Zitat: „Meine Heimat ist die wortlose Welt“ wird wohl für immer ein Kürzel für die Konfliktlinie der Handke-Kritik sein, die indes, wie Sartres Kritik an Ponge beweist, Ausdruck eines alten Problems ist, dem mit wohlfeiler Dichterbeschimpfung nicht beizukommen ist.