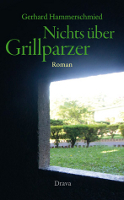Rein vordergründig sind es recht ordentlich erzählte Liebes- und Familiengeschichten, mit einer jungen Frau, Maria, die ein Kind empfängt und nicht recht weiß, von wem. Ist Anton der Vater, der Lover, oder Paul, der Ehemann? Auf alle Fälle steht in dem Roman nichts über Grillparzer geschrieben, außer dem, was Georg, ein gealterter Professor für Literaturwissenschaften, Marias Vater, über Grillparzer schreibt, über das Abgründige des biedermeierlichen Dichters, dessen Frauengestalten und deren Männergeschichten, und die Spukgestalten Grillparzers; Spezialgebiet: die Ahnfrau. Der Professor reist von Tagung zu Tagung, teilweise in Begleitung seines Sohnes Clemens und dessen Geliebter Klara, einer Fachkollegin des Professors, auf die der alte Herr auch einmal ein Auge gehabt hatte. Es eröffnen sich Schauplätze: Riva, Pesaro, kurz Bethlehem, sehr viel Nicaragua. Es eröffnen sich von dort weitere Dreiecke der Gefühlsverwirrung neben jenem zwischen Maria, Anton und Paul: Georg einst und jetzt zwischen Anna, der Mutter seiner Kinder, und Isabel, der Ärztin in Nicaragua, Welten und Generationen umspannend. Georg lebt zwischen zwei Welten und zwischen zwei Frauen, in ihnen sind die großen Frauengestalten Grillparzers in poetischer Weise nachempfunden. Die Figuren dieser bürgerlichen Familienaufstellung sind Schwärmer, welche es einst auf den anderen Kontinent verschlagen hat und die es weiter verschlägt, um dort aufs Neue la vida nueva zu suchen, die andere Möglichkeit des Lebens.
Hintergründig sind es recht unordentlich erzählte Gespenstergeschichten. Der Verbindungsmann zwischen Liebes- und Wahngestalt ist Anton, wie sein Freund und Rivale Paul der Psychotherapie verschrieben; Anton wird von Dämonen heimgesucht wie sein Onkel, der dörfliche Bestatter Johann. Die Mappe aus Johanns Nachlass ist in der Mitte des Romans eingebaut, um diesen quasi zu ‚erden‘. „Johann brauchte diese Schrift, und diese Schrift brauchte ihn.“ (S. 93) In seinen Aufzeichnungen charakterisiert und karikiert der ganz am Rand der Dorfgemeinschaft lebende Totengräber den real existierenden Katholizismus der Landbevölkerung mit ihrer hartgesottenen so genannten „Volksfrömmigkeit“ (S. 93) einschließlich der apotropäischen Riten rund um den Tod in schonungslos entlarvenden Beobachtungen, aus einfachsten Sätzen geschnitzt. Georg und Anton reisen einer Erscheinung in Obdach nach, am Friedhof des steirischen Ortes soll unversehrt von Verwesung und Zerfall der Leichnam einer Frau liegen (s. Leseprobe, S. 122-128). Die atavistische Welt der Steiermark trifft sich mit dem dämonischen Ritual, das Georg sich vom alten Nicaguaraner Luis berichten lässt: von der alten Frau in der Tempelruine, die, den Panzer einer Schildkröte umgebunden, ihr Gesicht mit einer Maske verhüllt, sich schöne Jünglinge zuführen lässt. Selbst Georg, der Professor, bleibt vor den Dämonen nicht verschont, er am wenigsten, „was hat dich mehr erschöpft, deine Studentinnen oder deine Dämonen.“ (S. 157) Am Anfang und am Ende des Diskurses über Gespenster steht die Referenz zu Grillparzers Ahnfrau, einer der mannigfachen intertextuellen Bezüge in diesem Roman, wie denen zu anderen Werken Grillparzers, zu Musil, zu Kafka, zum Nicaraguanischen Dichter Ernesto Mejía Sánchez, zu Mallarmé, zu Péguy und zu Rilke.
Wie geht dies zusammen und was sagt uns das alles? Natürlich haben die Liebe und die Dämonen viel miteinander zu tun. Dieses Zu-Tun-Haben bestimmt den Roman, implizit und explizit, oft als Dementi. Wie der alte Luis sagt: „ich weiß auch nichts. Sie kommen und gehen, wie sie wollen, belohnen nicht, bestrafen nicht. Aber glauben will das keiner. Nimm einen Trago.“ (S. 162) Der Schlüssel zum Verständnis bzw. die Barriere zum Nicht-Verstehen liegt in der Sprache und im Sprechen, in der Schrift. Der bewusst poetisch gestaltete Nebel der Sprache dieses Romans mit Sätzen, die oft irgendwo beginnen und nirgendwo enden, sorgt dafür, dass Grenzen verschwommen bleiben. Die Reflexion versagt, versiegt oft, nur der sorgsam Lesende kann die Stimmen der Erzählung unterscheiden. Vor klärenden Dialogen wird häufig eine Flasche Rotwein aufgemacht, am Ende der Dialoge, die keine vollständige Klärung gebracht haben, wird manchmal mit den Achseln gezuckt. Der Roman bricht mit Traditionen des Genres: Aus bleibt der Furor der Gespenstererscheinung aus dem romantischen Horrorroman. Aus bleibt die Gewissheit, ob es sie nun gibt oder nicht gibt, die Dämonen, ob sie eine Projektion der menschlichen Psyche sind oder Bodensatz eines anderen Raums. Das Rätseln des alten Professors muss letztlich ins Leere laufen. „Unsere Dämonen überkommt Verzweiflung, wenn wir sie wiederum in Projektionen halten wollen, wo uns doch die Projektile um die Köpfe sausen.“ (S. 181) Widergängerische Sätze wie „die Geschichten glauben an uns“ (S. 73) oder „die Toten deuten nur, deuten nur in uns“ (S. 127) oder „nach der Schrift kann man nicht leben, nur nach ihr“ (S. 138) bezeugen die Ratlosigkeit der Figuren, die sie aussprechen, und führen die Leser in fiebrierendes Nachdenken. Es liegt eine Philosophie in dieser Liebes- und Gespenstergeschichte verborgen, die an Kierkegaard erinnert, an Schopenhauer und Nietzsche, an Musils taghelle Mystik, an moderne französische Philosophen, die ich nie gelesen habe, wohl aber der Autor. Es ist eine Philosophie der Entgrenzung, der Aufhebung der Differenz zwischen Einbildung und Realität, zwischen Erkennen und Verkennung, zwischen Wahn und Wissen, zwischen Sein und Nicht-Sein, jawohl: dem Tod rückt dieses Buch zuleibe.
Eine unzeitgemäße Betrachtung ohnegleichen, ein grandioses Gedicht, ein Gespinst, das uns Spinnennebelfäden ums Gehirn treibt. Dieses Buch verdient Leser, die sorgfältig lesen können, auf die Übergänge achtend, den Wechsel der Erzählstimmen und der erzählten Stimmungen. Es ist nichts für die Eiligen, die Oberflächlichen. Es ist genug Spannung und Bewegung in den Liebes- und Gespenstergeschichten, aber dennoch ist es ein Buch für die Nachdenklichen und die tiefer Nachforschenden, ich weiß, dass es die gibt.