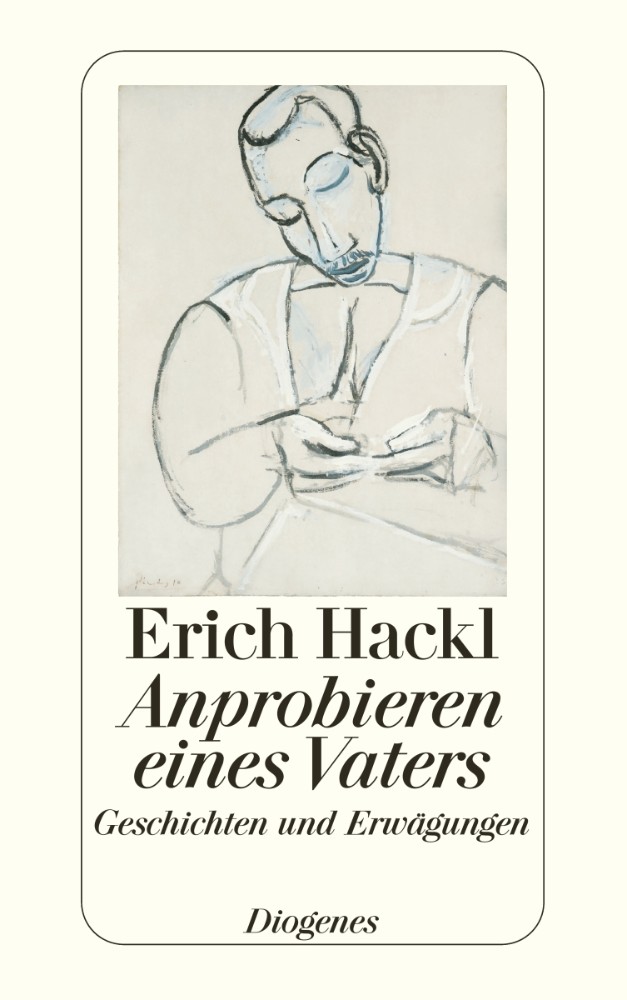Was die Erzählungen des Autors, von „Auroras Anlass“ bis zur „Hochzeit von Auschwitz“, im Großen leisten, das leisten viele der „Geschichten und Erwägungen“ dieses Bandes in der Miniatur, gleichsam auf engstem Raum: die exakt recherchierte, einfühlsame Darstellung eines Menschenlebens und seiner wesentlichen Stationen. Einzelne dieser Texte wirken wie überaus dichte Entwurfskizzen zu noch ungeschriebenen Romanen. Es sind vor allem Rückblicke in das zwanzigste Jahrhundert, die sich nie im Ungefähren verlieren, da sie immer einer individuellen Lebensspur folgen und viele, oft unbeachtete Perspektiven eröffnen. Beispielhaft dafür ist etwa die Titelgeschichte „Anprobieren eines Vaters“ (sie ist vor vier Jahren bereits als Hörspiel realisiert worden), in welcher der Autor von seinem Namensvetter Ferdinand Hackl erzählt. Der Text ist mehr als nur die Geschichte einer Jugend zwischen Repression und Kleinkriminalität im tristen Wien der Zwischenkriegszeit, er ist zugleich das Portrait eines einzelnen, der sich in den dreißiger Jahren als Kommunist engagiert hat und im Mordstaat der Nazis in einem KZ interniert worden ist; das Portrait eines Überlebenden also. „Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Von einer Kindheit zwischen Scham und Zwist. Von Eltern, die ihr Kind zu lieben vergessen, und davon, dass in einem Anstaltszögling kein Dieb, sondern ein Freiheitskämpfer steckt. Von einem Mann, der mir gesagt hat: Ich erzähle dir meine Geschichte. Der, während er erzählt, zu zweifeln anfängt, ob seine Geschichte erzählenswert ist.“ – In dieser Passage, die am Ende des Textes steht, wird einmal mehr Hackls demokratischer Erzählansatz deutlich: Der Diktatur eines ungehemmt waltenden Erzählers oder Berichterstatters, dessen übergeordnete Perspektive durch keine andere kontrastiert wird, setzt der Autor eine möglichst große Vielstimmigkeit und eine Vielfalt an Perspektiven entgegen.
Fast alle Geschichten gehören schließlich zum Erinnerungsbestand verschiedener Personen; jeder betrachtet sie von einem anderen Standpunkt und misst ihnen eine andere Bedeutung zu. Der leidenschaftliche Erzähler und Rechercheur Erich Hackl nun ergreift von den Geschichten, die er vorfindet oder denen er nachspürt, nicht Besitz, er ist nicht darauf aus, sie zu seinem Eigentum oder gar zum Demonstrationsobjekt seiner eigenen Ansichten zu machen. Dementsprechend werden die Portraitierten in seinen Texten immer wieder zu ihren eigenen Portraitisten, zu ihren eigenen Biographen; sie kommen wiederholt zu Wort und reflektieren den Weg, den sie gegangen sind und den sie weiterhin zu gehen gedenken.
Vor allem dieser portraitartige Zug ist es, der den meisten der hier versammelten Texte eignet. Hackl ist es in der Regel darum zu tun, seinen Lesern fremde Lebensläufe zu vermitteln, Lebensläufe, die keineswegs linear sind, sondern vielfach gebrochen und reich an Extremen, an Aufruhr und Leid. Er dokumentiert sie, allerdings nicht um der Dokumentation, sondern um des Potentials an individuellem Widerstand und humanistischem Engagement willen, das in ihnen steckt und an ihnen erkennbar wird. Hackl zeigt auf, wie wenig das alltägliche Leben (und wie wenig auch das Schreiben vieler Autoren) von den politischen Entwicklungen und Katastrophen zu trennen ist, und er sieht nie das eine ohne das andere. Wie er in einem Interview im Jahr 2002 betonte, ist es vor allem die politische Dimension einer Geschichte, die ihn dazu drängt, sie mit epischen Mitteln zu gestalten. So erzählt und berichtet er auch in dem vorliegenden Band zumeist von Menschen, die sich, in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten, einem Gewaltregime gegenüber sahen und nicht den Weg der Anpassung gingen, sondern den „anderen Weg“ (Richard Zach), den beschwerlichen Weg der Opposition, der schließlich in die Haft oder ins Exil führte. Das Gros der Schicksale, die Hackl in den Texten dieses Bandes mit lakonischer Genauigkeit nachzeichnet, sind Emigrantenschicksale.
Ein Schlüsseltext ist in diesem Zusammenhang die konsequent vielstimmig angelegte Reportage „Familie Fleischmann“; sie liest sich wie der Text zu einem Hörfunkfeature und zeichnet, in der Montage von Selbstaussagen einzelner Familienmitglieder, ergänzt durch die Kommentare des Autors, den Weg dieser Wiener Familie nach. Die Großeltern wurden von den Nazis ermordet, den Kindern gelang jedoch die Flucht nach Argentinien. Von dort mussten wiederum, in den siebziger Jahren, deren Kinder flüchten, um dem gewaltsamen Zugriff der Militärdikatur zu entgehen. Das Exil ist innerhalb dieser Familie also nicht nur die Erfahrung einer, sondern zweier Generationen.
Die Schriftstellerkolleginnen und -kollegen, die Hackl portraitiert, kommen aus unterschiedlichen, teilweise weit auseinander liegenden Traditionen und sprechen verschiedene Sprachen. Da stehen neben der 1939 aus Wien nach England emigrierten Stella Rotenberg, deren „Gesammelte Gedichte“ jüngst erst erschienen sind, der argentinische Schriftsteller Juan Gelman, dem die berührende Skizze „Der verwaiste Großvater“ gewidmet ist, und Mauricio Rosencof, ein uruguayischer Autor mit polnischen Wurzeln, dessen Erzählung „Die Briefe, die nie angekommen sind“ Hackl vor einigen Jahren ins Deutsche übertragen hat; da steht der 1975 ermordete salvadorianische Dichter Roque Dalton neben dem österreichischen Lyriker und Prosaisten Hans Raimund, den Hackl als „eine(n), der auf Hartlebigkeit baut“, den Lesern nachdrücklich in Erinnerung ruft. – Bei den großen Unterschieden im einzelnen ist doch allen diesen Autoren eines gemeinsam: Sie schreiben gegen die entfesselte politische Gewalt an, die sie, in je verschiedener Art und Weise, direkt oder indirekt, zu spüren bekommen haben; sie stehen für eine Poesie des Engagements und der Humanität, die sich nicht aus der Sphäre des Abstrakten herleitet, sondern immer vom Konkreten ausgeht.
Erich Hackl bedient sich einer klaren und schlichten, ungekünstelten Diktion. Er stilisiert nicht, er beschränkt sich darauf, zu registrieren und zu berichten, ganz wie ein Chronist; er belässt jede Geschichte in ihrem Recht und stülpt ihr keine wie immer geartete „Aussage“ oder „Moral“ über. Hackl schreibt ausschließlich von Dingen, die ihm nahe sind oder ihm nahe gehen und macht uns dadurch mitunter auch mit dem Fernen und bislang Unbekannten vertraut. Er maßt sich nicht an, über die Menschen, von denen er schreibt, Bescheid zu wissen, er nähert sich ihnen behutsam an. Gleichzeitig sind seine Texte keineswegs von einer kühlen Distanz gekennzeichnet, sondern vielmehr von großer Zuneigung, die allerdings nie vereinnahmend wirkt. Dafür beispielhaft sind seine Texte über die Journalistin Ruth Fischer („Angst vor dem Nacktsein“) und die Schriftstellerin Elisabeth Freundlich („Die Namen der Dinge“), die, in ihren jungen Jahren, das Los der Emigration miteinander teilten.
„Wer würdelos lebt, braucht sich nicht zu erinnern. Erinnern gibt Stoff, Würde verleiht Halt.“ Diese Sätze Mauricio Rosencofs stehen am Beginn des Portraits, das Hackl ihm widmet. Sie lesen sich als ein Motto für den ganzen Band, der darauf abzielt, wenig beachtete Zeitgenossen zu würdigen und auf diese Weise die Erinnerung an den Schmerz und die Empörung, die das letzte Jahrhundert wie wohl kein anderes zuvor gezeichnet haben, wach zu halten.