Im Zentrum der authentisch wirkenden, einfühlsam erzählten und auf einen dramatischen Höhepunkt zusteuernden, temporeichen und spannungsgeladenen Geschichte steht Erik Jäger, der seinem Namen alle Ehre macht. Nicht mit Pfeil und Bogen ist er unterwegs, sondern er vertraut ganz auf seine Sprechwerkzeuge sowie auf Intrigantentum, Lügengespinste und Berechnung.
Erik ist ein ausgefuchster Manipulierer. Er versteht es, sich vor anderen schön darzustellen und als verständnisvollen Partner zu stilisieren, dem es schwer fällt, „eine Person zu verlassen, die sonst niemanden hat“.
Selbst sieht er sich als „Durchschnittstypen mit dem gewissen Etwas“; eine Einschätzung, die von der Idee getragen scheint, unsere Gesellschaft würde nur das Mittelmaß honorieren, weil niemand Angeber mag oder sich gar mit „Losern“ umgeben möchte.
Die Lebensverhältnisse, denen er entstammt, passen genau in dieses Schema, arbeitet doch sein Vater als stellvertretender Leiter einer winzigen Raiffeisen-Filiale. Wenig überraschend gerieren sich seine Eltern daher als „unauffälliges Ehepaar aus der Provinz“. Man wohnt in einem gemieteten Reihenhaus, trinkt Sonntag Nachmittag mit den Nachbarn Kaffee und zeigt sich auch sonst kaum anders als „bieder und langweilig“.
Nicht dass sich Erik dafür schämen würde; besonders nahe steht er Mutter und Vater jedoch nicht. Zumindest weiß Freundin Mara auch nach zwei Jahren Beziehung „eigentlich nichts“ von ihm; nichts über seine Eltern, seine Kindheit oder seine früheren Beziehungen. Erik ist ein guter Bluffer. Er pokert nicht nur exzellent; er schafft es auch abseits des Kartenspiels den Menschen seiner privaten wie beruflichen Umgebung einiges vorzumachen.
Schon als „dahinvagabundierender Jusstudent“ verdankt er seine Dissertation der Hilfe eines unterbezahlten Universitätsassistenten, den ihm seine damalige Freundin spendiert. Vier Jahre später landet er in Wien, wo er schließlich von seiner Chefin für eine der neuen Post-Doc-Stellen am Institut „empfohlen“ wird. Dabei kommt leider auch heraus, dass große Teile seiner Doktorarbeit „abgeschrieben“ worden sind. Daher benötigt Erik „Verbündete ganz oben“.
So versucht er, die Gunst eines Sektionschefs aus dem Wissenschaftsministerium zu gewinnen, der „im Gespräch für einen Ministerposten“ ist; verlässt Freundin Mara, weil deren Familie ohnehin nur auf ihn „herabgeschaut“ hat; und geht ein Liebesverhältnis mit Sophie ein, die „schön, intelligent und wahnsinnig warmherzig“ ist und sich auch noch „fast beiläufig“ ihren Weg nach oben bahnt.
Und ganz nebenbei spinnt er an einem kleinen, feinen Lügengeflecht, in dem sich ein Professor für Staats- und Verwaltungsrecht verfängt, weil er eine Affäre mit einer Mitarbeiterin hat, die ihn wegen sexueller Belästigung eigentlich gern angezeigt hätte; dann aber doch lieber „Karriere macht – auf einem Posten, den (er) extra für sie geschaffen“ hat.
Damit Erik ihn nicht auffliegen lässt, verschafft ihm der Professor die „offizielle Bestätigung“, dass seine Doktorarbeit von der Universität „geprüft und als einwandfrei befunden worden“ ist. Somit steht einem Wechsel ins Kabinett des neuen Ministers nichts mehr im Wege. Erik wird „Referent für wissenschaftliche Projekte und Auslandsbeziehungen“. Am Schreibtisch im geschichtsträchtigen Palais am Stubenring sieht er sich „endlich dort“, wo er glaubt, hinzugehören.
So darf sich auch „das dunkelrote Tier“ in ihm, das zeitweilig „hysterisch lachen“ und „nach Mord und Vergeltung“ schreien muss, immer tiefer in ihn zurückziehen. Doch dann wirft ihm die Tochter seines Chefs „Gefühlskälte“ vor und dass er beim Sex mit ihr nichts anderes als „einen Porno nachspielen“ wolle, was „kalte Wut“ in ihm auslöst. Gerade jetzt, wo er es so gut wie geschafft und eine passable Karriere vorzuweisen hat, eine Wohnung, um die ihn viele beneiden, und eine „solide, gutherzige Frau“; da will er sich mit Sicherheit von niemanden mehr „zur Sau machen“ lassen, auch nicht von der Tochter seines Chefs.
Kein Wunder, dass sich unter diesen Umständen sofort wieder „das rote Tier“ bemerkbar macht. Erik Jäger geht es schließlich nur um eins: Dass sein Machthunger gestillt wird.
Sich diesem „urzeitlichen Grundbedürfnis“ hinzugeben, dafür sind die meisten Menschen jedoch „zu faul oder zu ängstlich“. Sie folgen lieber der Masse, anstatt die Richtung vorzugeben. Ganz anders die Alphas. Sie sehen es regelrecht als ihre Verpflichtung, sich durchzusetzen, „ohne sich von Gefühlsduselei aufhalten zu lassen“. Hat man nämlich ein großes Ziel vor Augen, kann man es sich nicht erlauben, „auf die Wehwehchen seiner Mitmenschen einzugehen“.
Erik ist so ein Typus Mensch: Egal, ob es um Freundschaft geht, um Arbeit, Politik oder um Liebe; er will bestimmen und beherrschen. Die Frage: „Wer ist oben, und wer unten. Wer übt Macht aus, und wer muss Macht über sich ergehen lassen?“ durchzieht dementsprechend den ganzen Roman. Erzählt wird (und das ziemlich profund) aus der Perspektive des aalglatten, eiskalten, karrieregeilen Protagonisten.
Marion Guerrero ist hautnah an ihm dran; an seinen Gedanken, seinen Gefühlen, seinem Leben. Sie zeichnet das fein ziselierte, markante, streckenweise sehr aufwühlende und beklemmende Porträt eines Psychopathen, der ausschließlich an seiner Selbstdarstellung und den eigenen Vorteilen interessiert ist.
Für so einen unangenehmen, andauernd ungestüm an den Zügeln zerrenden, rücksichtslosen Menschen Sympathie aufzubringen, das schafft nicht jeder. Eher hofft man, so jemandem im wirklichen Leben nicht begegnen zu müssen.
Zwischen den Buchseiten tut das Aufeinandertreffen ja alles andere als weh. Da avanciert es zum formidablen Lesevergnügen.
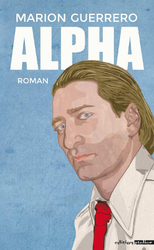
Alpha
// Rezension von Andreas Tiefenbacher
Um die These herum, dass wir im Grunde noch genauso funktionieren wie in der Steinzeit, weil es ja eigentlich immer bloß darum geht, möglichst weit die Stammeshierarchie hinaufzuklettern, baut Marion Guerrero ihren ersten Roman, der sehr schön veranschaulicht, warum es zwar jede Menge Betas und Gammas, aber nicht allzu viele Alphas unter den Menschen gibt.
Marion Guerrero Alpha
Roman.
Wien: Edition Atelier, 2018.
344 S.; geb.
ISBN 978-3-903005-42-6.
Rezension vom 07.12.2018
Originalbeitrag. Für die Rezensionen sind die jeweiligen Verfasser:innen verantwortlich. Sie geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion wieder.