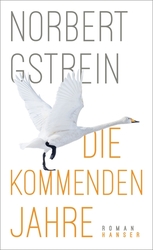Der Titel Die kommenden Jahre evoziert, der in Hamburg lebende österreichische Autor Norbert Gstrein sei unter die Futurologen gegangen. Falsch. Es geht in dem Roman nicht um Zukunft, es geht um Gegenwart. (Was sich freilich in den kommenden Jahren anders darstellen kann.) Ganz im Sinne des von Ludwig Börne am Beginn des 19. Jahrhunderts erstmals beschriebenen Zeitschriftstellers, dessen Aufgabe es sei „die Aussagen der Zeit zu erlauschen, ihr Mienenspiel zu deuten und beides niederzuschreiben“, erzählt Gstreins Roman von dem, was uns umtreibt: den Veränderungen in den USA nach der Wahl Trumps zum Präsidenten, den unterschiedlichen Haltungen zum Klimawandel, dem Umgang mit der Migration, der Frage, was denn nun Wahrheit, was moralisch richtiges Handeln sei, den Möglichkeiten und Wirkungen von Medien, der Bedeutung der Herkunft, … Das ist bei weitem nicht alles, was der Ich-Erzähler zur Sprache bringt.
Aber von vorne. Die Weltläufte sind durcheinander geraten. Es geht drunter und drüber. Was wäre ein geeigneter Fluchtpunkt? Für viele Menschen aus den Krisengebieten der Erde ist es Europa und da besonders Deutschland. So kommt das Ehepaar Richard und Natascha mit der Familie Fahri in Kontakt und überlässt ihr das Sommerhaus an einem See in der Nähe von Hamburg. Die Schriftstellerin Natascha Fahrländer – Richard wird im Buch mit ihrem Namen angeredet – ist dabei die treibende Kraft. Sie nützt die Aufnahme der Familie dazu, im Fernsehen und in Zeitungen darüber berichten zu lassen und arbeitet mit Bassam Fahri an einem Schreibprojekt. Der Ich-Erzähler und Gletscherforscher Richard hält sich zu Beginn in New York und dann in Kanada auf, wo er befreundete Forscherinnen und Forscher trifft. Die Kollegin Idea, Tochter einer vor den Nazis geflüchteten jüdischen Familie, nennt Natascha „ein blondes Monster der Moral“. Richard beginnt an ihrem Umgang mit der Familie Fahri, schließlich an der Tragfähigkeit der fünfzehnjährigen Beziehung zu zweifeln. Richards Fluchtpunkt war schon lange Kanada, wo er eine Professorenstelle annehmen könnte. Dort hat er in dem kleinen Ort Canaan einen Fahrradunfall. Der Ort, der nach dem Gelobten Land benannt ist, erweist sich dabei als abweisend, unheimlich und seelenlos.
Tatsächlich ist die Suche nach Kanaan/Canaan und die Frage, ob es dieses Land der Verheißung geben kann, das Thema, das den ganzen Roman irgendwie zusammenhält. Gibt es diesen Ort für Richard, Natascha, ihre Tochter Fanny? Für die vierköpfige Familie Fahri im norddeutschen Haus am See? Beim Versuch diese Fragen zu beantworten tauchen unvermittelt weitere Fragen auf. Was ist echt? Wie sind die Aussagen von (Natur-)Wissenschaft, die von Literatur zu bewerten? Ist Wahrheit bloß eine Frage des Preises?
Norbert Gstrein ist großartig im Erlauschen der Aussagen der Zeit. Es ist allerdings ein bisschen viel auf einmal. Manches erscheint einem deshalb etwas an den Haaren herbeigezogen, wenig verknüpft. Zumal da auch noch das romantische Motiv eines taubstummen Mädchens, eine veritable Kriminalgeschichte und … dazu kommen.
Dass sich Zukunft nicht endgültig voraussagen lässt, illustriert Norbert Gstrein übrigens anschaulich und herrlich zu lesen im dritten und letzten Teil „Die dreizehnten Kapitel“. Da gibt es ein „Ende für Literaturliebhaber“, „Ein anderes Ende“ und zuletzt „Was wirklich geschehen ist“. Auch hier erweist sich Norbert Gstrein bzw. der Erzähler, die übrigens etliche biographische Details miteinander teilen, als sensibler Protokollist der „Zeitinteressen“. Nach Börne sollte der Zeitschriftsteller darüber hinaus den Fortschritt befördern. Das scheint in einer Zeit, in der Kanaan entzaubert ist, nicht mehr so ganz einfach zu sein.