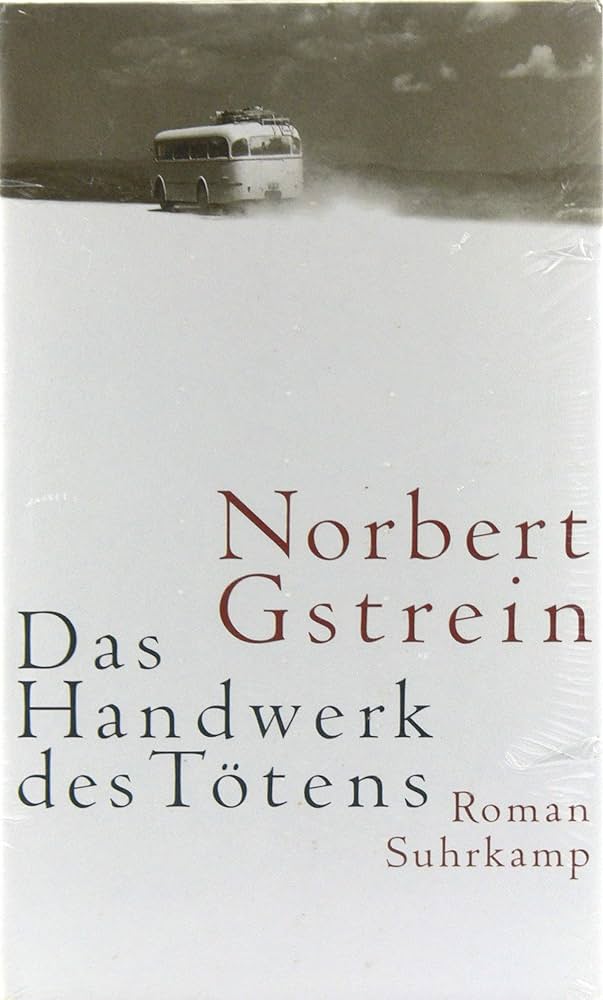Von diesem Kontrast handelt auch Das Handwerk des Tötens. Die Frage des Romans lautet, wie die Konstruktion der Wahrnehmung funktioniert, wenn im Bewusstsein Namen wie „Vukovar“ oder „Kosovo“ auftauchen. Sind doch die Fakten zu einem großen Teil Bilder und Meinungen. Und diese haben inzwischen ebenso eine (Nachkriegs-) Geschichte wie die Menschen, die als Soldaten, Marodeure, Internierungsopfer oder Flüchtlinge den Krieg erlebt haben. Die Authentizität der medial verbreiteten Bilder des Schreckens wurde bezweifelt, ihre Instrumentalisierung für politische Zwecke angeprangert (in Peter Handkes literarischen Reisen durch das ehemalige Jugoslawien etwa), der Krieg in den Medien ist selbst publizistisches Dauerthema. Aber die Bilder und Geschichten vom Balkankrieg wurden nicht nur durch Manipulationen unwahr; sie sind auch einem schleichenden Prozess des Verblassens und der Trivialisierung ausgesetzt.
Wo ist das missing link zwischen dem heutigen jovialen Kellner und dem damaligen warlord? Sind die „Traumstraßen in Jugoslawien“ noch jene Straßen, über die gerade erst Panzer rollten? Was hat „Miss Slavonski Brod“ mit der Frontstadt gleichen Namens zu tun? Die erzählerische Verheißung, die von den Kapitelüberschriften des Buches ausgeht – eine heißt gar „Eine schöne Geschichte“ – wird von Gstrein konsequent unterlaufen. Sie sind Köder, damit wir bei der Stange bleiben.
Gstreins literarische Fiktion setzt am Tod des Stern Reporters Gabriel Grüner an, der am 13. Juni 1999 im Kosovo ermordet wurde. In einem über das Internet abrufbaren Nachruf auf Gabriel Grüner heißt es, dass der Kriegsberichterstatter, der „zu einer journalistischen Elite“ gehört, „für die Wahrheit einen höheren Preis zahlen muss als ein Tischredakteur“. Es ist genau diese hilflose Floskelhaftigkeit, der Gstrein sein reflektiertes literarisches Verfahren entgegenstellt. Der Reisejournalist Paul ist von dem Vorhaben besessen, einen Roman über den im Kosovo erschossenen österreichischen Journalisten Allmayer zu schreiben. Der Tod Allmayers wird zu einem für Paul lebensbedrohlichen Phantasma; er lebt fast nur noch in den Recherchen für sein Buch. Der dilettierende Schriftsteller Paul ist auch ein Dilettant im Leben. Getrieben vom Verdacht, seine ehemalige Frau könnte mit Allmayer ein Verhältnis gehabt haben und unfähig, mit seiner schönen Freundin Helena ein neues Leben zu beginnen, wird die private und die historische Rekonstruktion zum Desaster. Die Aufklärung eines Verbrechens historischer Dimension mit den Beziehungsgeschichten der Rechercheure zu verbinden, bestimmte bereits Gstreins letzten Roman „Die englischen Jahre“ über einen vermeintlichen jüdischen Emigranten in England.
Erzählt, das heißt kommentiert werden alle im Roman kolportierten Geschichten von einem namenlosen Ich Erzähler, der dem Autor in seiner Skepsis und seinem Drang zur Relativierung wohl nahe steht. Ebenfalls Journalist, verliebt er sich in Helena, womit ein weiteres libidinöses Dreieck entsteht. Helena, die von aus Dalmatien nach Deutschland eingewanderten Gastarbeitern abstammt, Paul und der Erzähler fahren gemeinsam nach Kroatien; in Slavonski Brod treffen sie jenen selbstherrlichen, sonnenbebrillten ehemaligen Kriegsherrn, mit dem Allmayer ein Frontinterview führte, das eskalierte. In diesem Interview ging es um die zentrale Frage, wie es ist, wenn man jemanden tötet.
Wovon die Rede ist, dem Krieg auf dem Balkan und den Beziehungen der Figuren zueinander, davon wird fast ausschließlich in einer indirekten Erzählweise berichtet: Helena etwa erzählt dem Erzähler, was der in Zagreb an seinem Roman schreibende Paul ihr am Telefon erzählt hat. Gstreins Stärke ist es, die Kompliziertheit der gebrochenen Erzählperspektive in klaren, präzise gebauten Satzperioden aufzufangen. (Vor allem die im Gegensatz zu vielen anderen literarischen und journalistischen Texten makellose Zeitenfolge, die bei der Darstellung mehrerer Zeitebenen oft außer Kontrolle gerät, trägt zum Eindruck stilistischer Geschlossenheit bei.)
Die Banalität des Gesprochenen gehört zum Kalkül des Buches: Das hilflose Drauflosreden bei der Ankunft in Split mit einem Satz wie „Kaum zu glauben, dass vor ein paar Jahren noch Krieg war“ oder der ebenso oft gehörte Satz, wonach die verfeindeten Parteien sich ausbluten müssten, bevor sie vielleicht zur Vernunft kommen. Aber auch in seiner reflektierenden Kommentierung kann das Banale banal bleiben. Das Buch ist von manchmal quälender Langatmigkeit. Gstreins Anspruch, Kitsch und Kolportage durch distanzierende Indirektheit zu bannen, also dem zu entgehen, wovon die Schreibenden in seinen Büchern ständig bedroht sind, führt auf der anderen Seite manchmal dazu, dass sich das Erzählte eben doch wieder in Binsenweisheiten aufzulösen droht, nach dem Muster: Alles Reden über den Krieg erzeugt nur Banalitäten oder: Jede Deutungshoheit ist angemaßt. (Der Reporter Allmayer hält die rhetorischen Fragen nach der Ursache des Bürgerkriegs immer weniger aus.) Gegen sein Ende hin entwickelt der Roman jedoch einen überraschenden erzählerischen Sog. Ganz unerwartet schießt in die Hohlformen der love story und des Politthrillers die story. „Das Handwerk des Tötens“ endet mit einer starken „Pointe“, mit einem Schuss, von dem nicht ganz klar ist, wer ihn abgegeben hat.
Gstreins Misstrauen gegen die alle Zweifel beruhigende story und gegen einen wohlfeilen Betroffenheitsgestus angesichts des Krieges mündet immer wieder in eine Polemik gegen Schriftsteller als moralische und mediale Kriegsgewinnler. (Angespielt wird unter anderen auf die Amerikanerin Susan Sontag, die sich während des Krieges eine Zeit lang in Sarajewo aufgehalten hat.) Auch wenn man Gstreins Einschätzung des (österreichischen) Literaturbetriebs in manchem teilt, jede zur Schau gestellte Betroffenheit ekelhaft findet und nicht daran glaubt, dass Schriftsteller per se auch gute politische Kommentatoren sind: für manche der Attacken auf für Insider relativ leicht zu entschlüsselnde Akteure wäre der Platz eher der politische Essay als der Roman.
Die Recherche so voranzutreiben, dass sie sich gegen die Rechercheure richtet, mit dem fragilen Status des Recherchierten auch die Identität der Rechercheure fraglich erscheinen zu lassen, dabei den Journalismus als wichtigstes Medium unserer Welterfahrung mit seinen eigenen Mitteln vor sich her treibend – das ist Gstreins Kunst. Dieses langsame Aufweichen der historischen Fakten in kreisenden Erzählbewegungen war in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur sonst nur die Domäne des vor zwei Jahren gestorbenen W.G.Sebald.
Fast alle sind wir bloß mediale Zaungäste der Katastrophe, die über Das Handwerk des Tötens nur aus zweiter Hand Bescheid wissen. Norbert Gstreins Roman dokumentiert die schwierige Suche, für die uns allen geläufige Erfahrung, dafür meist die falschen Worte zu finden, die richtigen Worte zu finden. Das ist etwas, was nur die Literatur kann.