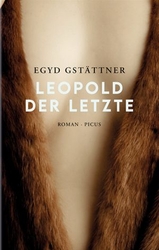Sacher-Masoch lernen wir als den „sonderbarsten Dichter aller Zeiten“ kennen, es ist der 1835 in Lemberg in Galizien geborene und 1895 in Lindheim verstorbene Verfasser der Novelle Venus im Pelz (1869 erschienen), der Bibel des Masochismus, einer Neigung (Veranlagung? sexuellen Störung? psychischen oder psychiatrischen Krankheit?), welcher der sonderbare Dichter den hinteren Teil seines Namens überlassen musste, das besorgte 1886 der Professor für Psychiatrie Richard von Krafft-Ebing. Eine der vielen Auswirkungen der Lektüre von Leopold der Letzte: Ich besorge mir eine wohlfeile Taschenbuchausgabe der ominösen Novelle und lese im Nachwort die Studie über den Masochismus von Gilles Deleuze, die auch Gstättner für seinen Roman als Quelle diente. Die Romanfigur Xaver Saxer ist auch Schriftsteller, er war auch zwei Mal verheiratet, einmal schlecht, einmal gut, auch von der Leidenschaft/Krankheit Masochismus schließlich vor seinem Lebensende geheilt. Mit Sacher-Masoch verbindet den Romanerzähler noch einiges andere, zum Beispiel eine schopenhauerische Weltsicht, und es gleichen sich die Erfolgskurven der beiden Autoren im literarischen Betrieb. Xaver Saxer wollte ein Buch über Sacher-Masoch schreiben, er erzählt über Sacher-Masoch in der Form eines Berichts über seinen Arbeitsprozess. Das ist ziemlich raffiniert, es bewirkt, dass uns beim Lesen die Biographie Sacher-Masochs unmittelbarer und näher erscheint als bei einem ausgeblendeten Biographen. Der Ich-Erzähler erlebt bei der biographischen Rekonstruktion sein eigenes Leben ein zweites Mal, all die Erniedrigung, Enttäuschung, Krankheit, alles selbst durchgemacht, selbst den Tod.
Was wir immer schon über den Tod wissen wollten
Eine Parallele zwischen Sacher-Masoch und Saxer besteht darin, dass beide ihren eigenen Nachruf zu lesen bekommen. Daraus entwickelt sich die außergewöhnliche Perspektive einer Geschichte, die post mortem erzählt wird: nachdem Saxer in der Zeitung einen Nachruf auf sich liest, der Arzt seinen Tod feststellt, die Seele vom unbestatteten Körper ausgehaucht ist, sie sich frei von raumzeitlichen Bindungen bewegen kann – in der Literatur ist eben alles möglich! Die Bestattung der Leiche unterbleibt wegen der Pandemie, ausgelöst von einem Virus, das aus einem ukrainischen Frauengefängnis ausgebrochen ist, es heißt Feminacapta.
Dieses Buch ist so recht ein Buch über den Tod. Ausführlich beschrieben werden Schmerzen, innere und äußere Leiderfahrungen, Krankheiten aller Art.
Schluss mit Lust!
Es ist wohl eines der ernsteren Bücher Egyd Gstättners, der ja als Satiriker für seinen galligen Humor bekannt ist. Mit seinem Memento mori und mit dem ausufernden Fabulieren beim Verweben des Biographischen mit dem Autobiographischen wirkt der Roman barock. Das zeigen schon die Kapiteltitel, der erste lautet: „Wie ich von meinem Tod erfuhr. Wie Doktor Sick meinen Tod feststellte und wie mein Nachruf leider nicht besonders groß ausfiel, weil gleichzeitig mit meinem Ableben ein Rolling-Stones-Konzert stattgefunden hatte“. Man merkt, dass Satire und Humor nicht fehlen, doch auch das geflügelte Wort vom Lachen, das im Hals stecken bleibt, trifft nicht, nein, man lacht einfach, obwohl vom Sterben die Rede ist. Außerdem kommt der Satiriker in den Seitenhieben gegen den Literaturbetrieb durch, egal ob 19. oder 21. Jahrhundert, ob Graz, Leipzig oder Paris, stets dasselbe Bild der Lächerlichkeit. En passant erzählt Saxer von seiner Begegnung mit „Monsieur Grmpff“, „dem fulminantesten Literaturstar der westlichen Welt, zu einem Clochard verkommen, rauchend, die Zigarette zwischen Mittel- und Ringfinger eingeklemmt, eine Flasche Jameson vor sich stehend“. (S.56) Wer damit wohl gemeint ist?
Barock mutet auch die Verbindung von Erzählen und Räsonieren an. Verhandelt werden in dem Roman wichtige aktuelle Diskurse, neben der Pandemie auch die Themen Pornografie, Psycho(patho)logie, Psychotherapie und der literarische Produktionsprozess. Die schriftstellerische Arbeit erscheint als einzig mögliche Form der Therapie, den Höhepunkt des Grotesken bildet eine Therapie-Schilderung im Kapitel 33 „Die Sitzung, die Therapie und der Tod“ gegen Ende des Romans, in der die Therapeutin Doktor Zelenetskaya sich auf den Patienten setzt: „ein Bein […] über das andere, allerdings ganz vorsichtig und so, dass mein Mund durch ihr Geschlecht und meine Nase durch ihren Anus weiterhin fest verschlossen blieben, so dass Atmen ausgeschlossen war“. (S.313) In dieser porno-parodistischen Szene wie auch in den wiederkehrenden Seitenhieben gegen den Verfall der Ehe und in zivilisationskritischen Rundumschlägen verfährt der Roman mit einer Rücksichtslosigkeit gegen neo-libertinäre Benimm-Codes, die Alois Brandstetter, Gstättners Lehrmeister, gewiss das Herz höherschlagen lässt. (Siehe Leseprobe) Man könnte mancherorts Misogynie (des Autors?) herauslesen. Ich tue das keineswegs, halte all das für eine ehrliche, sympathische Form von legitimem Protest mit einem Schuss Selbstironie. Die barocke Abkehr von der Welt, die Verkündung der Vanitas, das offene Eintreten für Masturbation statt offenem Ausleben der Lüste, diese lustvolle Lustfeindlichkeit ist keinesfalls mit Altersresignation zu verwechseln. Es ist: Engagiertes Eintreten für eine Existenz jenseits des Lustprinzips mit sehr vielen Rufzeichen!
Insiderei
Nicht wenig rücksichtslos verfährt das Roman-Ich mit seinen Gegnern im literarischen Feld. Eine Feindin von Xaver Saxer ist Frau Professor Doktor Frauke Riesendampf, die Leiterin des Zentralinstituts für Literatur, sie hat Saxer „totgeschwiegen“ (S.104), das rächt sich:
„Die Leiterin des Literaturhauses Frauke Riesendampf hatte in der Intensivstation übrigens besonders schwere Feminacapta-Symptome gezeigt. Das Beatmungsgerät nützte nichts mehr. Nach Ansicht der behandelnden Ärzte starb sie japsend eines besonders qualvollen Todes. Frauke Riesedampf wurde aber natürlich in ein anderes Jenseits eingeliefert. Die Universität schaltete eine Standardparte, das Institut ebenso. Still trauerten das Rektorat, die Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde und Studierende, aber niemand namentlich. Die Zeitung begnügte sich mit einem Einspalter als Nachruf. Durch rege Publikationstätigkeit war sie ja nicht gerade aufgefallen.“ (S.275)
Unschwer lässt sich in Xaver Saxer ein Alter Ego Egyd Gstättners erkennen, schließlich hat der Protagonist seinen Namen vom Schwiegervater des Autors verliehen bekommen, das ist sozusagen die Duftmarke des Autobiographischen. Eine Menge weiterer privater Details und solcher der Schriftsteller-Laufbahn stimmen überein. Wer aber ist mit Frauke Riesendampf gemeint? Dem Eingeweihten erschließt sich glasklar: Anke Bosse, die Leiterin des universitären Robert-Musil-Instituts und Literaturhauses in Klagenfurt! Was vom „literarischen Zentralinstitut“ im Roman steht – „Dort verachtete man mich. Mit den Insassen verband mich blanker Hass und ein langer kalter Krieg“ (S.15) – ist von der Realitätsebene her in einem Punkt allerdings zu dementieren. Zwar hat das Institut und Literaturhaus in Klagenfurt Egyd Gstättner, den produktivsten, unterhaltsamsten und seltsamsten unter den lebenden Dichtern der Stadt, tatsächlich in völlig ungerechtfertigter Weise „mit Ignoranz und Schweigen“ (S.105) bedacht, also links liegen gelassen, aber einer der „Insassen“ dieses Instituts ist der Schreiber dieser Zeilen, und der hat alle Bücher Egyd Gstättners mit Leidenschaft und Lust gelesen und dieses letzte, Leopold der Letzte, hält er bis zum letzten Wort für gelungen.