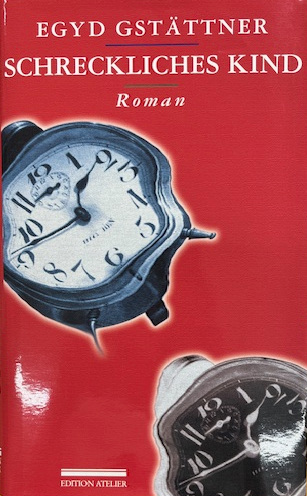Beinahe aber hätte Egyd Gstättner, der Misanthrop unter den österreichischen Schriftstellern, das Erscheinen seines Buches verhindert: Er nahm die Idee des Films – junger Mann reist per Zeitmaschine in die Rocking Fifties zu seinen noch nicht verheirateten Eltern – auf, um das erzählende zeitreisende Ich und so auch den Roman „Schreckliches Kind“ zu unterbinden. Als gescheiterter Autor der Bücher „Kleine Weltgeschichte der Irrtümer“ und „Die sieben Kränkungen des Menschen“ möchte Gstättners Roman-Ich seine Eltern, vor allem den Vater, davon überzeugen, daß es besser sei, ihn nicht zu zeugen. Der Zeitreisende versucht sogar, ganz im Gegensatz zu Marty McFly im Film, seine Mutter zu verführen; dies zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht seine Mutter sein konnte – vor der Hochzeit mit seinem Vater: „Die Frage ist, wie ich es anstellen soll, daß sich meine Mutter so wie im Film tatsächlich Hals über Kopf in mich verliebt. Mit egozentrischem Oberschenkelkneten, Würstelwackeln und Muttertagsgedichten wird seinerzeit aller Voraussicht nach nicht viel zu bestellen sein.“ (S. 59)
Gstättner, der seine beträchtlichen literarischen Fähigkeiten als Autor u. a. von „Spielzeug“ und „Servus oder Urlaub im Tauerntunnel“ in kleine Formen gegossen hat, versucht sich in Schreckliches Kind wieder am Roman. Wohl um den Ruf des Satirikers, den er hat, auf Distanz zu halten, führt er die Figur des Felix Doppelhofer, seines Zeichens Säufer und Satiriker, ein. Dieser Doppelhofer geistert lange Zeit schemenhaft durch den Roman, bis ihm letztendlich doch noch die gebührende Aufmerksamkeit zuteil wird. Schreckliches Kind ist ein Roman im Kopf oder genauer: in der Einbildungskraft. Sein Stil ist das Räsonnement, das die erzählerische Grundidee – Wie kann ich schreibend die existentiellen Voraussetzungen für das Schreiben außer Kraft setzten? – permanent variiert und bis in jeden Winkel ausleuchtet. Da kommen Dispute vor, litaneiartige Abhandlungen, Erinnerungen an die Kindheit in der österreichischen Provinz, aber auch Schimpftiraden. Und es werden Heiligtümer der österreichischen Hochkultur wie der allsommerliche „Jedermann“ vorgeführt, etwa wenn das zeitreisende Ich betont, „Jedermann Teil 1“ geschrieben zu haben, den eigentlichen „Jedermann“.
Gstättner bringt es fertig, eine amüsante und unwahrscheinliche Grundidee ernsthaft und zugleich unterhaltsam abzuhandeln. Hat sich die Misanthropie Gstättners in seinen früheren Büchern noch hinter der Satire versteckt und ist sie deshalb als bernhardeske Attitüde mißverstanden worden, so tritt sie hier offen zutage: Sie tritt zutage, um zu scheitern. Der Autor stellt die Frage, wie der Roman denn enden soll. Und nach einigem Hin und Her schreibt Gstättner Sätze, die sein poetisches Credo sein könnten: „Jeder Dichter, der die Welt nicht zum Einsturz bringt, ist in Wahrheit ein gescheiterter Dichter. In mir aber fordert die gesamte Weltliteratur des Pessimismus jetzt endlich ihr Recht, ich verlange die lebensweltliche Konsequenz. Ich will keinen Roman über das Nichtsein schreiben, ich will nichtsein. Ich will endlich nichtsein.“ (S. 166) Später bricht der Roman ab, was ja zu erwarten war, und gibt dem Satiriker das Wort.
Das große Vergnügen beim Lesen der Gstättnerschen Was-wäre-wenn-Erwägungen wird leider ein wenig von den Fehlern des Buches getrübt. Beharrlich ist da etwa von „Jokatse“ die Rede, und nur die vielen Beistrich- und sonstigen orthographischen Fehler, insbesondere bei Fremdwörtern, halten den Leser davon ab, das als Ironie zu verstehen. Es ist traurig, daß nur wenige Verlage in Österreich sich einen Lektor leisten können.