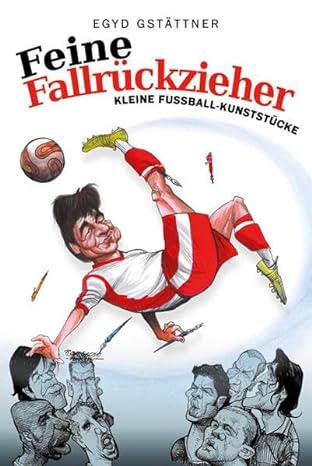Der Fußball-Hype in der Literaturszene wird von Männern angekurbelt: Eben erst sind zwei Anthologien erschienen: „Seitenwechsel“, herausgegeben von Samo Kobenter und Peter Plener, und „Als ich einmal Harreither in der Dusche interviewte“, das Fußballbuch von Wendelin Schmidt-Dengler und Andreas Weber. Fußball ist hierzulande also nicht mehr das, worüber die Herren der Kultur die Nase rümpfen. Im Gegenteil, es drängt sich der Verdacht des Konjunkturrittertums auf. Zwar gibt es mit Ödön von Horváths „Sportmärchen“ und Robert Musils Sportglossen prominente österreichische Gewährsmänner aus der Zwischenkriegszeit und Muster für hochintellektuelle literarische Verarbeitung des Sportgeschehens, aber im Vergleich mit Musil und Horvath, die ihre Texte nicht medienwirksam auf große Events zugeschnitten schrieben, stehen Franzobel & Egyd Gstättner ’näher am Mann‘, das will heißen, die Satire Musils und Horváths trifft nicht bloß die Haut wie die Satire Franzobels und Gstättners, sondern Scharniere und Gelenke. Sprachkünstlerisch auf allerhöchstem Niveau hat der Ungar László Darvasi in seiner „Weltgeschichte des Fußballs“ Spielverläufe ‚dekonstruiert‘ , unter dem Titel „Wenn ein Mittelstürmer träumt“ ist das Buch 2006 bei Suhrkamp erschienen – rechtzeitig zur WM in Deutschland.
Wenn ich sage, Egyd Gstättner stehe mit seinen „Feinen Fallrückziehern“ ’nahe am Mann‘, dann meine ich das aber trotzdem als Kompliment und empfehle den Ankauf der gesammelten Fußballphilosophie des wackeren Klagenfurter Autors und Kickers als Begleitbuch zum nun in wenigen Tagen beginnenden EURO-Stress mit ganzer Überzeugung. Es ist ein Buch für viele, auch in der Gestaltung. Gstättners ‚Fallrückzieher‘ bieten gewiss Unterhaltung für alle, die sich vom Fußball (mehr oder weniger) unterhalten fühlen, in den Fußballglossen Gstättners wird auch noch die Langeweile produktiv, die die öden Championsleague-Übertragungen zwischendurch auslösen, weil die Gstättnersche Kunst der Satire eben genau da besonders ansetzt, wo Fußballkunst nicht sonderlich spannend ist, sondern retortenmäßig, kommerzialisiert, medialisiert, politisiert, mehr Blabla als Aktion hat – bei den Aporien des Hochleistungssports also. Ob das Gstättner überhaupt recht ist, wenn ich ihm attestiere, dass seine Fußballtexte nicht nur U-Wert besitzen, sondern auch als E-wertig gelten können? Etliche Glossen sind leider so gut gelungen, dass sie es verdienen, ERNST genommen zu werden. Nicht dass der Autor weniger an dem Buch verdient, wenn sich das herum spricht!
Gstättners Glossen vermitteln mir Einsichten: zum Beispiel in die Zusammenhänge zwischen Sport und Spiel und Literatur und Spiel, zwischen Sport und Ästhetik und Literatur und Ästhetik. In unvergleichlicher Brillanz biegt die Glosse „Das Licht im Estádio da Luz“ (siehe Leseprobe) die pseudointellektuelle Vorstellung über Identität von Körperbewegung und Intelligenz hin zu einer Spitze und bricht mit ihr, in dem Satz „diesmal zappelt der Ball ziemlich unintellektuell im Netz“ (94). Das ist meisterhaft! In der Glosse „Weihnachtsfeiersport“ gelangt Gstättner von der „sprachschöpferischen Kraft“ des Fußballs zum identitätsstiftenden Potential des Sports, in der kleinen biografischen Enthüllung vom kleinen Egyd und seinem „eigenen Wiener Stadthallenturnier“ und seiner „eigenen Vierschanzentournee“ (126). Was da vor dem Satz „Ich war ein sehr einsames Kind“ erzählt ist, geht uns, einst kleine Buben, jetzt große Männer, wohl irgendwie alle an, finde ich. Es rührt an Urgründe, wo Idole, wo Fiktionen entstehen, wo die Kraft der Imagination herrührt, wo der Möglichkeitssinn sich entzündet. In der ‚Urszene‘ von dem einsamen kleinen Buben zum Beispiel, der in einem staubigen Hinterhof einen Ball gegen die Wand drischt und sich vorstellt, er wäre ein Star. Für die Enthüllung dieser Urszenen bin ich als Leser wirklich dankbar!
Stets präsent bleibt in den Glossen der Sport als gesellschaftliche Paraphrase. Seine Rituale und Liturgien und die Metaphorik der Sportsprache ‚dekonstruiert‘ die Satire unablässig. Sie ‚entwickelt‘ Typisches und Typen, die in der Sportwelt eine Rolle spielen, wie Positive aus Negativen in Dunkelkammern entstehen, Dispositive: der Trainer, der Schiedsrichter, der Fan, der Kommentator, usw. Die Satire macht Verwandlungen offenbar und nimmt Verwandlungen vor, ein Mensch wird zur Persona, zur Maske, zur öffentlichen Maske, die jeder wieder erkennt, zur Figur, über die jeder verfügt (Menschen wie Krankl, wie Hickersberger etwa). Gstättner nutzt auch das utopische Potential der Satire, so wenn er den Schiedsrichter der Zukunft fantasiert: „Der Hauptdarsteller ist der Referee, die restlichen 22 sind Statisten, die ihn mit ‚Euer Ehren‘ oder ‚Hohes Gericht‘ anzusprechen haben. Er ist der mit Abstand am besten bezahlte Akteur am Platz, betritt den Rasen unter Hymnenklängen auf einem roten Teppich und nimmt beiden Teams die Parade ab. Von oben bis unten ist er mit Sportlogos vollgepflastert, nur sein Haupt ziert eine weiße Lockenperücke.“ (164)
Mein einziger Einwand gegen die Fallrückzieher: es sind zu viele. Die Lachmuskeln erlahmen, das Lachen läuft sich langsam tot für den Leser. 72 Fußballglossen! Gegen Ende des Buchs kreuzen die Müdigkeit des Lesers und die Unermüdlichkeit des Autors die Bahn. Gstättner hat wohl alle Glossen und Satiren, die irgendwie mit Fußball zu tun haben, die er zwischen 2001 und 2007 in der „Presse“, der „Kleinen Zeitung“ und der „Süddeutschen Zeitung“ veröffentlicht hat, in den Sammelband genommen. Auch die weniger brillanten. Vielleicht hätte er das nicht tun sollen. Vielleicht wäre weniger mehr gewesen. Es stellt sich die Frage nach der Lesbarkeit. Kann man (kann frau?) Gstättners Glossen auf einen Sitz konsumieren? Die Antwort: Während der EURO ja. Dann lesen wir den langweiligen letzten Teil des Buches, wenn die Österreicher schon ausgeschieden sind und wir uns die Zeit vertreiben müssen, wenn wir fadisiert auf die Matches warten, die uns nichts mehr angehen.