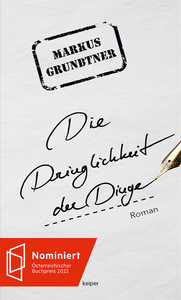Die beiden letzten Regeln bringen aber bald die erwähnte Liste gehörig durcheinander, als er am Wiener Margaretenplatz Klaudia Antonini kennenlernt. Sie zieht einen Reisekoffer zu einem offenen Bücherschrank und stellt „Schulbücher für Italienisch und Latein“ sowie eine zweisprachige Ausgabe von Italo Svevos Zenos Gewissen hinein. Mathias geht zum Bücherschrank, nimmt den Roman heraus. Klaudia überlegt es sich anders, bittet um das Buch. Mathias hat auf der neuen Liste an Regeln schon den Punkt „Gehen Sie auf faszinierende Menschen zu“ abgearbeitet und will Punkt drei versuchen, Klaudia in ein Gespräch zu verwickeln, doch so schnell lässt sie sich nicht einwickeln. Vor allem, weil Mathias es mit der Rechtssprache versucht, ihr den Unterschied von Eigentum und Besitz erklärt. „Ist Sachenrecht nicht wunderschön?“, fragt er und erwartet ein Lachen, auf das er mit einem Lachen antworten wird, doch Klaudia stürmt davon.
Aber auch Mathias gibt nicht so schnell auf. „Unter den Büchern im Bücherschrank war Zenos Gewissen die größte Herausforderung. Anscheinend hält der heutige Tag noch mehr Herausforderungen für mich bereit.“ Viel Zeit hat er nicht. Um 10.30 Uhr fährt Klaudias Bus. Nach dreizehn Jahren in Wien will sie nach Triest zurückkehren.
Grundtner beschreibt dieses Kennenlernen mit viel Witz und arbeitet in rasanten Dialogen Mathias‘ und Klaudias Charaktere heraus. Schnell wird klar: er spricht die Rechtssprache, sie die Sprache der Literatur, er Rechtslatein, sie Italienisch. Und doch verstehen sie sich auf Anhieb, nun ja, im zweiten Anlauf. Mathias folgt ihr und diesmal kommen sie ins Gespräch. „Klaudia mit K und nicht mit C“, antwortet sie auf Mathias‘ Vorstellung und nimmt ihn mit auf „einen letzten Spaziergang“ durch Wien, wie sie sagt.
Als Mathias ihr das Gebäude der Rechtsanwaltskammer in der Rotenturmstraße zeigt, hält ihm Klaudia einen Fünf-Euro-Schein hin. „Das ist meine Anzahlung auf dein Honorar. Du sollst mein Anwalt sein, also mir gegenüber voll loyal und absolut verschwiegen. So kann ich dir Dinge erzählen, die ich sonst niemanden erzählen würde.“ In Wien wollte sie Lehrerin werden, am liebsten für Italienisch und Literatur. „Anfangs“, erklärt sie, „war Wien ein ‚Was alles sein könnte‘, nun ist es ein ‚Was nicht alles hätte sein können‘.“ Sie hat nie eine Stelle an einer Schule bekommen und dann hat sie ihr Freund verlassen. „Mir wird klar“, stellt Mathias fest: „Ich suche die drei K, sie die drei L: Liebe, Literatur, Lehre.“
Und ein weiterer Unterschied, abseits ihrer verschiedenen Sprachen, ihrer divergierenden Listen, wird Mathias klar. Für sein Bewerbungsgespräch hat er sich mit ausgefallenen Fragen vorbereitet, die ihm gestellt werden könnten. Eine davon, „Wenn Sie ein Gewässer wären, welches wären Sie?“, fragt er Klaudia, die ohne zu zögern antwortet, sie wäre das Meer. Mathias will die Antwort, die er für sich zurechtgelegt hat nicht preisgeben. „Sag schon“, fordert Klaudia ihn auf. Es ist ein Kanal, also „ein künstliches Gewässer“, muss er zugeben. „Ein abgesicherter offener Wasserlauf. ein Bauwerk des Verkehrswesens. Nach vorgegeben Regeln errichtet, lenkt er einen Fluss, der sonst alles mit sich reißen würde, in eine geordnete Bahn. Das Wasser im Kanal strömt also auf ein Ziel zu und wechselt dabei nie seine Richtung.“
Trotz oder vielleicht wegen dieser Selbsteinschätzung entschließt sich Mathias am Ende des zweiten Kapitels, Klaudia nach Triest zu begleiten, den Bus um 10.30 Uhr zu nehmen. Mit Hilfe Klaudias, die ihm ein Ticket gekauft hat, braucht sie ihn doch, um in Triest für die Wohnung ihrer Kindheit, die nun wieder auf dem Markt ist, einen Mietvertrag abzuschließen. „Dich hat das Schicksal geschickt“, sagt sie. Beim Gespräch mit dem Makler wäre ein „Mann an der Seite“ besser. Ob nicht ein Schauspieler reichen würde, fragt Mathias. „Ich will nicht irgendwen als meinen Anwalt und Partner vorstellen“, wiegelt Klaudia ihn ab.
Wird sich das Schicksal so einfach in ein Mathias‘ Regelwerk einordnen lassen? Er lässt es darauf ankommen, steigt ein und versucht die Dinge anders zu sehen. Im Bus beginnt er etwa mit dem Vorwort zu Zenos Gewissen. Er schläft zwar darüber ein, entdeckt aber zuvor noch, „wie der Protagonist sich in sein Ich gräbt und alles Mögliche entdeckt.“
Und nach dem Besuch von Klaudias Kindheitswohnung und dem Gespräch mit dem Makler gibt er zwar zu, dass „Jus […] eine Brille [ist], die man aufsetzt und nie wieder abnimmt“, doch konkretisiert er, dass auch „zwischenmenschliche Beziehungen […] eine Frage von Besitzansprüchen [sind], von echten und von vorgetäuschten.“
Auf das Kennenlernen, auf dieses erste gemeinsame Abenteuer in Triest folgt ein Verstehenlernen der Sprache der/des anderen und, soviel, darf verraten werden, eine Liebesgeschichte, die Grundtner sehr schön erzählt. Während er die Rasanz der Dialoge beibehält, lässt er seine Figuren nie den Atem verlieren, sich früher oder später immer aussprechen, voneinander lernen. Auch wenn Mathias‘ Juristenhumor das für Klaudia manchmal schwierig macht. Wie am Ende des dritten Kapitels, als sie sich in Triest zum Abendessen verabreden, und sie ihn fragt, was sein Lieblingsgericht sei.
Das „Handelsgericht“ natürlich.