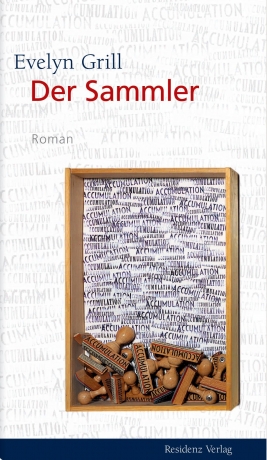Mit dem Phänomen der „Messies“ bzw. dem sogenannten „Vermüllungs-Syndrom“ beschäftigt sich die Psychologie seit den 80er Jahren, Erklärungsmodelle für die Entstehung einer derartigen Neurose gibt es zahlreiche. Evelyn Grill, die mit Alfred Irgang einen solchen „Messie“ in den Mittelpunkt ihres neuen Romans stellt, nähert sich dem Phänomen auf ihre eigene Art an: ästhetisch, nicht psychologisch. Warum Irgang ein Messie ist, bleibt Nebensache; ihr Sammler ist ein moderner Sisyphos und damit im Sinne Camus‘ ein glücklicher Mensch. Im Übrigen heißt es lapidar: „Er war nicht zu verstehen.“
Statt Erklärungsversuchen für Irgangs Verhalten liefert uns die Autorin daher Beschreibungen seines Alltags, und dabei ist Evelyn Grill eine Klasse für sich. Die einfühlsame Darstellung des Lebens ihres sammelwütigen Helden mit Anteilnahme zu verwechseln, könnte sich allerdings als Irrtum herausstellen: Nicht zufällig vergleicht ihr im Roman auftretendes Alter ego das Einfühlungsvermögen einer Schriftstellerin mit der „Empathie einer Katze, die eine Maus zu Tode spielt“. Um ein ähnlich grausames Spiel handelt es sich auch bei der Handlung des „Sammler“.
Alfred Irgang lebt zwar abseits der Gesellschaft und ihrer Ordnung, hat aber nicht alle Brücken zu ihr abgebrochen. Er nimmt regelmäßig am Stammtisch seines Jugendfreundes Gregor Voss teil, der inzwischen Professor geworden ist. Dieser Stammtisch stellt den Gegenpol zu Irgang und seiner chaotischen Welt dar: Die intellektuelle, aber nicht sonderlich geistvolle Runde könnte nicht konventioneller und berechenbarer sein: man trifft sich beim Nobelitaliener, trinkt schönen Wein, hört Vivaldi und unterhält sich über Akademisches. Ohne Mitleid, dafür aber mit sichtlicher Liebe zum Detail stellt die Erzählerin die Schwächen der Mitglieder dieser Runde bloß, gelegentlich wirken sie überhaupt wie personifizierte schlechte Eigenschaften; Eitelkeit, Dummheit, Gefühlskälte und Egoismus geben sich so ein regelmäßiges Stelldichein. Sprechende Namen wie Uta Aufbau, Dora Stein oder Hugo Bosart bzw. Apostrophierungen wie „der Professor“, „die Sozialpädagogin“ oder „der Galerist“ unterstützen diesen Eindruck.
Das gewählte Verfahren verfehlt seinen Zweck nicht. Der in seinen öden Ritualen gefangene Stammtisch, an dem sich die Gespräche genauso im Kreis drehen wie die persönliche Entwicklung seiner Teilnehmer steckengeblieben zu sein scheint, ist ein geschickt arrangiertes, liebevoll bösartig gestaltetes Bild für eine in ihren Konventionen erstarrte Gesellschaft. So lähmend ihr Konformismus für die einen ist, so bedrohlich wird er für alle, die sich ihm nicht unterwerfen: Besonders von Irgangs Lebensweise fühlt sich die Runde naturgemäß irritiert und verunsichert, somit auch herausgefordert. In seiner Abwesenheit wird über Möglichkeiten, ihn zu therapieren, diskutiert, und als der Sammler für längere Zeit ins Krankenhaus muss, bietet sich die Gelegenheit, seit langem gehegte Pläne in die Tat umzusetzen. Ohne allzu viel von der Handlung verraten zu wollen: die versuchte Zwangstherapierung geht natürlich schief, der Stammtisch muss sich eingestehen, dass sein Handeln letztendlich eher von Intoleranz und dem Drang nach Bevormundung als von Hilfsbereitschaft geprägt war. Dass ihm mit Alfred außerdem die eigene Raison d’être abhanden gekommen ist, bemerken seine Mitglieder erst dann, als es zu spät ist.
Das Interesse für Existenzen am Rande der menschlichen Gesellschaft, für Beziehungsunfähigkeit, vor allem aber für Dekadenz und Verfall sind Konstanten in Evelyn Grills literarischem Oeuvre geworden, denen sie in jedem ihrer Bücher neue Aspekte abgewinnt. Sie hat sich mit dem „Sammler“, wie schon in „Vanitas oder Hofstätters Begierden“, eine Figur als Titelhelden ausgesucht, in die sich hineinzuversetzen weder der Erzählerin noch ihren Lesern leicht fallen kann. Dass es Evelyn Grill dabei gelingt, Verständnis für jemanden zu entwickeln, den man im Grunde nicht verstehen kann, ist ein weiterer Beweis für die Gediegenheit ihrer Erzählkunst.