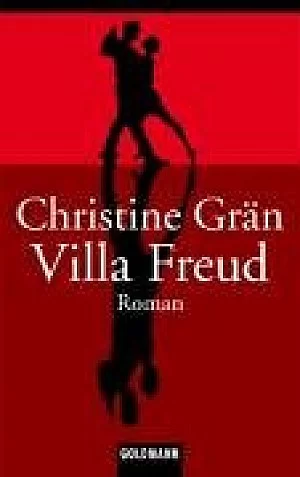Das neue Buch von Christine Grän beginnt vielversprechend. Eingezwängt in ihre neurotische Kleinbürgerfamilie schwelgt die blutjunge Agatha Bronner in Wagnerschen Welten. Sie singt Isoldes Sterbearie mit dem kämpferischen Trotz der Jugend, während ihr die unerbittliche Familienidylle die Luft abdrückt. Agatha singt aber auch von Trauer und Schuld, denn der Unfalltod ihrer kleinen Schwester Margareta, für den sie sich zumindest moralisch verantwortlich fühlt, lastet schwer auf dem Gewissen.
Christine Grän, die im Vorjahr mit „Hurenkind“ zu Recht einen Treffer gelandet hat, nennt ihren neuen Roman Villa Freud und löst sofort Assoziationsketten aus, verleitet zu Amateurpsychogrammen. Doch kaum beginnt man die Familie Bronner in Freudsche Fallbeispiele zu ordnen, tritt diese schon wieder ab, und man muss mit Agatha, die sich in memoriam an die tote Schwester nun Rita nennt, in die Welt ziehen.
Nächste Station: Auftritt der Wagnersängerin. Ritas Vorsingen an der Frankfurter Oper endet als Desaster. Aus der kindlichen Brust wollen sich keine Wagnerklänge pressen lassen. Also wird aus Rita Greta, ein unbeschriebenes Blatt. Sie driftet nach Berlin und singt als miese Zweitbesetzung in einer Jazzband. Lebt von der Hand in den Mund, driftet weiter, heiratet unvermittelt einen argentinischen Patrizier und heißt von nun an Margarita. Driftet mit ihm nach Buenos Aires in eine morbide Familie der argentinischen Oberschicht, wo ihre latent lesbische Schwägerin als Psychiaterin in einem Stadtteil namens Palermo arbeitet, der im Volksmund wegen seiner dichten Konzentration an Seelenklemptnern auch „Villa Freud“ genannt wird. Voilà!
Die Ehe scheitert und Margarita, die sich jetzt Meg nennt, landet am A. der Welt im antarktischen Ushuaia, wo ihr Leben wieder einmal von vorn beginnt. Da passiert etwas Ungewohntes, zumindest ungewohnt bei Christine Grän Büchern, klammheimlich hat sich Langeweile eingeschlichen. Das Stationendrama spinnt sich mit der Zähigkeit und Glaubwürdigkeit einer Fernsehsoap fort und hat den Leser irgendwann auf der Strecke gelassen. Und obwohl Christine Grän ihre Heldin in immer neue bizarre Situationen versetzt und eine Reihe schräger Vögel vorbeiziehen lässt, gelingt es ihr nicht mehr, den Spannungsbogen zu halten. Denn ihre „Villa Freud“ beherbergt keine abgründigen Traumata, man findet darin lediglich klebrige, höchstens knietiefe Melancholie, die die Welt mit einem einförmig grauen Schmutzfilm überzieht. Die Protagonistin mit dem verzweifelten Hang zum Besonderen irrt zunehmend gestaltloser durch die Geschichte, bis sie schließlich am 11. September 2001 in Boston eine Boing 767, Flugnummer 11, mit Zielort Los Angeles besteigt. Es ist amerikanischer Schicksalstag und, was nicht schwer zu erraten ist, wohl auch ihrer. Christine Grän schenkt ihrer blassen, traurigen Heldin wenigstens einen spektakulären Abgang von der Bühne des Lebens.