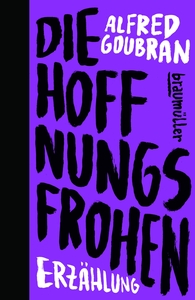Elias, so sein Name, hat sich auf seinem Marsch (seiner Flucht?) verlaufen und wird von Franziska, einer Einheimischen, aufgelesen und in ihrem Haus untergebracht. Nach und nach erfahren wir, dass der Protagonist, der aus einfachen Verhältnissen stammt, schon seit Kindheitstagen mit dem Alleinsein, seiner treuesten Begleiterin, vertraut ist und in ihr jene Geborgenheit gefunden hat, die ihm seine Familie versagte. In einem von Sprachlosigkeit geprägten Milieu aufgewachsen, erwirbt der Vielleser Elias autodidaktisch eine philosophisch-literarische Bildung, die sich als dünner, unsystematisch aufgetragener Firnis erweist. Was ihn indes antreibt, ist die Sehnsucht nach den großen Wörtern, die, in den Büchern verborgen, Träume und Zündstoff zugleich darstellen.
Es scheint daher kein Zufall zu sein, dass er nach einer Nacht bei Franziska den Weg hinauf zum Schwarzen Schloss einschlägt und an der offenen Pforte klingelt. Isabel, die weltläufige, in Portugal aufgewachsene „Tochter des Hauses“, empfängt den Besucher, weist ihm ein Zimmer zu und zeigt ihm seinen künftigen Arbeitsplatz. Elias soll die seit Jahrzehnten unbenutzte Bibliothek der Familie Schwarzkogler ordnen und neu katalogisieren. So vergehen Wochen, in denen die Sonne nicht aufgeht und Elias nie das Bedürfnis verspürt, in den weitläufigen Park hinauszugehen, über dem sich die verschneiten Berge wie unüberwindbare Palisaden auftürmen.
Mehr und mehr taucht der junge Mann in das anachronistische Ambiente des Schlosses ein, wo die Segnungen der digitalen Ära noch nicht Einzug gehalten haben. In dem bildschirmlosen Landsitz, der mit einer fensterlosen Mönchszelle ausgestattet ist, gleichsam um zum Rückzug vom Rückzug zu einzuladen, scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Rasch findet sich der Fremde in dieser romantisch-antiquierten Umgebung zurecht und versucht zunächst noch, den Bestand der Schwarzkoglerischen Bibliothek zu sichten und das vorhandene Ordnungssystem zu durchschauen. Allmählich aber macht er sich schmökernd mit dieser kuriosen Büchersammlung vertraut, deren verstaubte Bände die entferntesten Wissensgebiete umfasst. Zunehmend verliert sich der ehemalige Schulabbrecher und Gelegenheitsbibliothekar während seiner Tätigkeit in diesem papierenen Wissensfundus und begibt sich dabei auf eine faszinierende Reise durch die dort versammelte wissenschaftliche Literatur, die Elias zugleich mit der Geschichte des Anwesens vertraut macht. Dabei erfährt er, dass Isabels Vater, ein Arzt, krebskranken Patienten und ihren Familien in den umliegenden Waldhäusern sowie im Dorf eine von der Außenwelt abgeschirmte Bleibe geschaffen hat. Ob Elias das Geheimnis dieser arkanen Gemeinschaft lüften wird, verschweigt die Erzählung, nachdem sie unsere Neugier aufs Äußerste angestachelt hat.
Was also hat das potenzielle Publikum von Goubrans Die Hoffnungsfrohen zu erwarten? Wer diesen Band, den fünften einer auf sieben Bücher angelegten Erzählserie, zur Hand nimmt, sieht sich zunächst mit einer stilistisch höchst anspruchsvollen Prosa konfrontiert, die sich vor allem durch elliptischen Ausdruck und Lakonie auszeichnet. Ein derartiger Stil fordert die routinierte Leserschaft folglich dazu auf, die syntaktischen und inhaltlichen Leerstellen zu füllen, was durchaus dem enigmatischen Gestus der Erzählung entspricht. Diese gibt sich ähnlich wie der symbolische Ort der Bibliothek als ausuferndes Verweissystem zu erkennen, in dem Kafkas Schloss und Borges‘ labyrinthische Bibliothek neben etlichen anderen intertextuellen Versatzstücken glücklich koexistieren. Goubrans Buch macht Belesene gewiss froh und stößt weniger Erfahrene möglicherweise vor den Kopf, zumal wenn der Erzähler seine waghalsigen Exkurse in das Wesen des Bewusstseins bilderreich entfaltet. Wie entstehen Gedanken? Wie funktioniert unser Denken? Wer sind wir, wenn wir denken? Dies sind nur drei jener Fragen, welche die vorliegende Neuerscheinung in einer gelungenen Mischung aus fiktionaler Erzählkunst und wissenschaftlichem Diskurs auf kluge und anregende Weise stellt. Wer sich auf Goubrans unterhaltsames Literaturspiel einlässt, wird jedenfalls mit Spannung und Witz belohnt. Ungestüm tollen „Gedankenhündchen“ und „Zitierpudel“ herum, laufen über die Textoberfläche und reflektieren den irrlichternden Prozess unserer Denkbewegungen, deren Systematik kein noch so erfahrener Bibliothekar zu begreifen vermag. Über das Denken auf literarischem Niveau zu philosophieren ist sicher nicht jedermanns Sache. Goubran gelingt dieser Parforceritt indes bravourös, und es darf vermutet werden, dass diese aparte Erzählung dazu angetan ist, seine Fangemeinde zu vergrößern.