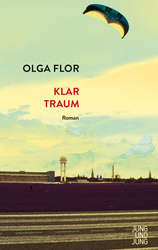Den Angelpunkt dabei bildet die Geliebte, die mit dem Kürzel P bezeichnet ist, der Liebhaber A hat kaum etwas zu sagen – und will und kann das anscheinend auch gar nicht. Die Geliebte bekommt in Olga Flors Text eine Stimme, wie sie sie sonst noch kaum in der Literatur erhalten hat. In fortgesetzten Rückblenden, Erinnerungen und Gedankenspielen dekliniert P die Phasen des Ver- und Entliebens im selbstreflexiven Spiel der Worte durch. Dennoch lässt sich die Konzentration der Erzählung auf den Blickwinkel der Geliebten nicht in simpler Weise als Akt der Machtergreifung, indem sie das Wort ergreift, interpretieren. Ihr gehört zwar das Wort, doch dadurch ist noch nichts gewonnen. „Ihm fehlen die Worte, er stürzt sich Hals über Kopf in die Sprachlosigkeit.“ (S. 202)
Für einfache Siege und wohlgestimmtes Glück ist die Darstellung der Liebe unter den Bedingungen des Kapitalismus deutlich zu illusionslos geraten. Doch gerade die Reste des romantischen Begehrens erweisen sich in höchstem Maße als unpraktische Begleiter von Liebesleben und Liebesenden. Die Anklänge an die Forschungen zur Ökonomie der Emotionen bzw. der Emotionalisierung der Ökonomie, für die z.B. die Soziologin Eva Illouz mit ihrem Buch „Der Konsum der Romantik“ steht, sind nicht nur in der Erzählung selbst präsent, sondern werden auch in den geschilderten Gedankengängen der Geliebten P deutlich sichtbar. Sie ist sich ihrer klar unterlegenen und nachteiligen Situation sehr wohl bewusst, versucht aber dennoch die Kontrolle zu erlangen. Sie betrauert ungebrochen ihr von ihr selbst erwartetes Scheitern. Der Text bleibt stets nah bei der Geliebten P – mit zwei wesentlichen Ausnahmen: In einer Art Nebenhandlung wird von G erzählt, einer Paketbotin, deren Leben schon fast als glückliches geschildert wird. Zur Haupthandlung steht ihre Geschichte mehr im Kontrast, als dass sie mit ihr in Verbindung tritt. Die zweite Ausnahme gönnt Flor ihren LeserInnen gegen Ende des Romans, als sich die Perspektiven zu verschieben beginnen und das Gedankenkreisen der Geliebten einmal mehr – und diesmal von außen – einer gnadenlosen Korrektur anheimfällt.
Schon zuvor findet sich unter dem Titel „Vom Leben in den großen Städten“ ein Kapitel, das eine so geschlossene wie bittere Poetologie der Liebesgeschichte liefert, dass die Vorabveröffentlichung als eigenständiger Text in der Zeitung Der Standard nur logisch erscheint. Darin seziert Flor die Erwartungen des zeitgenössischen Lesepublikums innerhalb der Konventionen der Liebesgeschichte, die nun idealerweise in einer Fantasywelt stattzufinden hat, um auch ein ökonomischer Erfolg zu werden. Die skizzierte Story verwurstet die vorstellbaren Klischees in gedrängtester Form und stellt sie dabei lustvoll auf den Kopf. Flors Roman definiert sich zu großen Teilen auch durch all das, was er sich gerade nicht erlaubt. Nicht umsonst findet keine Entlastung der Geliebten statt, und wenn der Umschlagtext wie auch Rezensionen vom vielleicht vorhandenen „Trost“ oder einem gelingenden „Entlieben“ sprechen, dann werden sie dem Ernst und der Härte, mit denen Olga Flor ihrer Figur begegnet, kaum gerecht.
P bleibt eine Gefangene ihrer Liebe, auch wenn sie genau weiß, dass sie wohl unter ihrem Niveau liebt. So meint sie: „Es war wohl das am nächsten an Liebe heranreichende Gefühl, zu dem er fähig ist, das muss ich endlich begreifen. Mehr ist da nicht.“ (S. 112) Allerdings liebt sie auch über ihrer eigenen Eigentumsklasse, denn A ist bedeutend vermögender und kapitalstärker als sie. Es ist nur eine von vielen Ungleichheiten, die dieses Liebesverhältnis auszeichnen. Für die Geliebte ist ihr Verhalten von ständigen Akten des Interessensausgleichs gekennzeichnet: „Merkt, wie sie panisch durchrechnet, an welchem Posten des Gefühlshaushalts sich weitere Abstriche machen ließen, einnahmenseitig, um die Bilanz zu retten“ (S. 18). Flor sorgt durch das Zusammenspiel von kristallklarer Introspektion und hilflosem Ausgeliefertsein an die Emotion bei ihrer Hauptfigur durchaus für Irritationen bei der Lektüre, so etwa wenn sich ihre Geliebte an ihren A wendet: „Du verschiebst einfach alles, was dir zu anstrengend ist, so verschiebst du auch mich, doch es ist allein meine Schuld, dass ich mich verschieben lasse, dass ich immer noch hoffe und an dir hänge, an der Idee von dir. Ich sollte meine Gefühle längst schon umgemünzt haben, umgewidmet auf gewinnbringendere Anlagen.“ (S. 152) Um die Komplexität von Flors Roman zu illustrieren, reicht es übrigens, im vorangegangenen Zitat das „Du“ nicht mit dem Geliebten A, sondern mit einer klassischen Vorstellung von „Literatur“ gleichzusetzen. Denn dass in „Klartraum“ nicht einfach eine Liebesgeschichte erzählt wird, sondern mehrdeutige Lektüren geradezu provoziert werden, legt die formale Gestaltung des Romans nahe.
Auch die Namenlosigkeit der Figuren erzeugt eine zusätzliche Ebene der Distanz. Alexandra Millner berichtet in ihrer Rezension für den Falter, dass Olga Flor sich dabei auf biochemische Reaktionen des Coenzyms ATP bezieht, das durch Abspaltung der Phosphatgruppe P den intrazellulären Energielevel aufrechterhält. Und das zusätzlich zu den Anleihen bei Goethes „Wahlverwandtschaften“ (Falter Bücher-Herbst 2017, S. 27). Im Roman selbst werden immer wieder weitere Deutungsmöglichkeiten angeboten, für P und A zum Beispiel „Protagonist“ und „Antagonist“, „Pünktchen und Anton“ oder „Projektmanagement“ und „Abwicklung“, so dass ein fortwährendes Spiel mit den Bedeutungen und Deutungen in Gang gehalten wird.
Den Roman als rein literarische Versuchsanordnung zu lesen, verbietet sich jedoch schon durch seine unübersehbare Einbettung in die Gegenwart. Dass auch das Thema der Flucht, der Konfrontation mit den Gräueln des Kriegs Anteil am Roman hat, sorgte in Rezensionen beinahe für Vorwürfe. Als ob ein literarischer Text entweder ausschließlich oder überhaupt nicht davon handeln dürfe. Flucht und Krieg werden im Roman als präsent im Leben der Hauptfigur dargestellt, aber mit der schwankenden Wichtigkeit, die diesen Fakten in den westlichen Gesellschaften zukommt. Doch gerade in diesen Nebenszenen wirkt P manchmal nahbarer als in ihrer Konzentration auf den Geliebten. Wenn sie über das Töten denkt: „Ein Außersichsein angesichts der Selbsterhöhung und Anmaßung, die darin steckt, jemand anderem das Leben zu nehmen“ (S. 57), dann ist damit in wenigen Worten viel gesagt. Für P ist die Zeit, in der sie lebt, immer Thema, doch die Liebesbeziehung ist ihr das Zentrum, auch wenn sie um die Vergeblichkeit weiß: „Das Habenwollen, nicht Bekommen, so einfach ist das, this Notget.“ (S. 46)