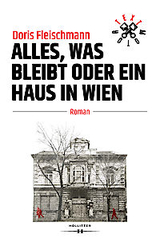Eine davon ist die Schriftstellerin Christiane Winter, die in der Wohnung im zweiten Stock vom hinterlassenen Geld ihrer Eltern und diversen Nebenjobs lebt. Unter anderem erledigt sie für den Antiquitätenhändler Daniel Goldmann, dem die Dachwohnung gehört und dessen Geschichte den schmalen Roman eröffnet, „Korrespondenz und Buchhaltung“. Außerdem denkt sie daran, einen Roman zu schreiben. Doch passend zur „pessimistischen Grundeinstellung“, die in Wien „richtig ansteckend“ zu sein scheint, gibt sie diesen Plänen keine große Hoffnung. Die Idee, „der Nachwelt etwas Bleibendes“ zu hinterlassen, lässt sie allerdings nicht los.
Und genau um diese Thematik kreist auch der Roman, der versucht, dieses „Alles, was bleibt“, das er im Titel führt, an Erinnerungen, die Menschen haben, festzumachen. Denn scheinbar ist es wirklich so, dass außer ihnen recht wenig bleibt. Zumindest sieht das die 77jährige Tessa Bäumer so, die in jungen Jahren mit „einer Wandertruppe (…) durch die deutsche Provinz getingelt ist“. Sie, die die „besten Jahre ihres Lebens“ mit einem Varieté-Künstler verbracht, später einen Fußballtrainer geheiratet und „große Angst vor dem Sterben“ hat, geht „niemals ungeschminkt aus der Wohnung“.
Sie fragt sich jetzt, was sie tun könnte, um „bei vielen Menschen in guter Erinnerung zu bleiben“. Tessa denkt ein Projekt an, das sich um „junge Wohlstandsverwahrloste“ kümmert und möchte dafür auch Sebastian Hartmann begeistern, der mit seinen Eltern im dritten Stock wohnt und kurz vor der Matura steht. Während er „in der Schule ein Hilfsprogramm für Flüchtlinge gestartet“ hat, leitet sein Vater den Wert einer Sache oder Initiative rein davon ab, wieviel Geld sie einbringt. So findet sich klarerweise „immer ein Thema zum Streiten“. Sebastian betrachtet seinen Vater als „Schnösel“ und sein Zuhause als „Notschlafstelle“, kann er doch mit seinen Eltern „einfach nicht reden“. Das fällt ihm aber auch mit der Studentin Sofia, die nicht bereit ist, „sich auf eine Liebesgeschichte“ mit ihm einzulassen, alles andere als leicht.
Doris Fleischmann verhandelt in ihrem Erstling einige recht aktuelle Themen: die Liebe eines Jugendlichen, dessen Großeltern noch „echte Sozis“ gewesen sind, zu einer Muslimin; den Stellenwert von Religion, die gerade bei Menschen, „die nicht selbst denken wollen und sich wahnsinnig wichtig nehmen“, hoch in Kurs steht; oder etwa die schwierige Situation im Buchhandel.
Dass selbst eine Lesung mit dem amerikanischen Bestsellerautor Christopher Zweig nicht genügt, um die im Erdgeschoß liegende Buchhandlung von Eva Wolf vor der Insolvenz zu retten, scheint symptomatisch. Sie hat „den Niedergang des Buchhandels nicht in dieser Geschwindigkeit kommen sehen“, ihn eigentlich gar nicht sehen wollen; ja immer wieder gehofft, „dass alles so bleibt, wie es ist“. Aber genau das tut es nicht.
Dass alles so bleibt, wie es ist“, davon lässt sich nicht ausgehen, befindet sich doch alles in ständigem Wandel. Eine Botschaft, die die Autorin sehr nuanciert und behutsam zu vermitteln versucht.
Im Zentrum dieses Wandels, der angetrieben von den Schlägen des Schicksals mal langsamer, mal schneller vor sich geht und dessen facettenreiche Darstellung beeindruckt, steht eine recht „eigenwillige Gemeinschaft“, die Christiane Winter, als nach dem Tod ihrer Eltern ihr Bedürfnis nach Familie und Zusammengehörigkeit sehr stark wird, in eine „funktionierende Hausgemeinschaft“ umwandeln möchte.
Am Ende sieht das Ergebnis (bei aller Vergänglichkeit) recht tröstlich aus. Schließlich „geht doch nichts über eine gute Nachbarschaft“.