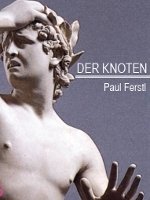Die in häufigen Vor- und Rückblenden diskontinuierlich erzählte Geschichte berichtet von einem jungen, aufstrebenden Manager, der mit einigem Erfolg im väterlichen Konzern arbeitet, sich für Literatur und Oper interessiert und ganz und gar nicht dem Stereotyp eines in Zahlen verliebten Geschäftsmannes entspricht. Von seinen pointierten Repliken angetan, lässt sich die Romanistik- und Philosophiestudentin Bernadette, die potenzielle Partner nach ihrer Belesenheit und Kultiviertheit beurteilt, auf diesen nicht alltäglichen Mann ein. Obgleich er sie nicht schön findet, trifft er sie wieder und gerät in eine Beziehung, die sich auf sexueller Ebene schwungvoll entwickelt, ansonsten nicht das große Glück zu versprechen scheint. Als er sich eines Tages „auf die Suche nach Ablenkung“ macht und dabei auf einen Knoten in Bernadettes linker Brust stößt, schlägt dieses Verhältnis in eine existenzielle Herausforderung um, dem der weltläufige „Händler, der drei Sprachen fließend beherrschte“, à la longue nicht gewachsen ist.
Also wieder eine Liebesgeschichte, mag der leicht blasierte Leser denken. Aber mit literarischer Hausmannskost gibt sich Ferstl nicht zufrieden, selbst wenn es in seinem Buch vielfach um das Zubereiten und Verzehren von Speisen geht. Wir werden Zeugen, wie die Figuren genüsslich Schweinsbraten und fetttriefendes Mark verzehren und Knoblauchzehen, weil sie davon nicht genug bekommen können, mit bloßen Fingern aus der Pfanne fischen. Pasta versinkt in Olivenöl und Parmesan, südländischer Wein wird in Kanistern mitgeführt, die während des Urlaubs befüllt werden, damit niemand dürsten muss. Die Protagonisten schwelgen in lukullischen Genüssen und erleben sich dabei in gegenseitiger Übereinstimmung, wie der Ich-Erzähler zufrieden anmerkt: „Bernadette leckte mir das Fett aus den Mundwinkeln. Schnaps half anschließend der Galle.“ Die Gefräßigkeit, mit der sie sich ihren Gaumenfreuden hingeben, spiegelt jene andere unersättliche Lust, mit der sie im Bett, Arme und Beine verknotend, übereinander herfallen.
Der Knoten ist ein Fest der Sinnlichkeit, wo Leben und Sterben einander berühren, wo sich Unfälle und Todesfälle häufen. Und die Beschreibung dieser archaisch verbrämten Welt verlangt nach kraftvollen Bildern, in denen Schlachtszenen und das qualvolle Ende von Tieren gleichermaßen dargestellt werden. Diese dionysisch und doch düster anmutende Stimmung schlägt den Leser von Anfang an in ihren Bann und bereitet auf den Leidensweg der krebskranken Bernadette vor. Unbarmherzig wird der langsame körperliche Verfall der Protagonistin bis zur Vollendung der Tragödie dokumentiert. Pathographisch penibel werden die Auswirkungen der Chemotherapie auf die Freundin aufgezeichnet, während der Mann an ihrer Seite krampfhaft nach seinem Selbstbild sucht, als ob dieser Frage gerade in diesem Moment höchste Priorität zukomme.
Diese etwas unterkühlte Figur, die im Berufsleben perfekt funktioniert, bleibt in der Realität der Gefühle ein der Beobachtung verhafteter Zaungast. Als Siebzehnjähriger, erinnert sich Bernadettes Gefährte, wurde er zufällig Zeuge, wie ein Motorradfahrer stürzte und auf der Fahrbahn liegen blieb: „Als ich den Daumen auf die Stelle legte, aus der das Blut fuhr, fühlte ich mich nicht anders, als würde ich einen Wasserhahn zudrehen.“ Ebenso wenig geht ihm der Selbstmord seines Vaters unter die Haut. Erst Bernadettes Siechtum und schließlicher Tod wühlen ihn auf eine noch nie dagewesene Weise auf und schaffen eine Verwirrung, die er in keine der ihm zugänglichen Erfahrungskategorien einzuordnen vermag: „Ich wusste ja nicht, was ich sagte; was ich sagen sollte.“ Dieser Seelenverwandte von Hoffmannsthals Lord Chandos verfügt, wie ihm sein Vater bescheinigt, über „keine eigene Sprache“ und wirkt, selbst wenn er sich geistreich gebärdet, konturlos und schal. Die Namenlosigkeit, die der Autor über diese Figur verhängt hat, scheint diesem Makel geschuldet und sühnt ihn zugleich. Doch für Metaphysik ist in Ferstls kraftstrotzender Prosa kein Platz. Man ist entweder gesund oder krank und wird gleich dem symbolischen Grashalm, den Bernadette zu Beginn der Erzählung auf der Terrasse ihres Liebhabers ausreißt, vernichtet. Dieser ernüchternde, absurde Blick auf das Dasein hält Ferstls kühnen Text im Innersten zusammen und verleiht ihm einen ernsten Charme, der das gelungene Debüt auszeichnet.