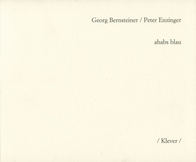Waren Bernsteiners Arbeiten in mechanismen und defekte großteils fetzige Zeichnungen mit englischsprachigen Sprüchen, voller Motive der Popkultur und eines ausschweifenden, selbstzerstörerischen Lebens, sind es jetzt sehr behutsam und äußerst präzise ausgeführte, rätselhafte Figuren in zarten Pastellfarben. Die schnell und impulsiv, oft mit dicken schwarzen Strichen aufs Papier gebrachten Zeichnungen, zwischen kindlich und aggressiv changierend, sind nun sparsam gesetzten, statischen, farblich akzentuierten Figuren gewichen, die gelegentlich pflanzliche oder tierische Formen erahnen lassen. Die vorherrschenden Farbtöne sind verschiedene Abstufungen zwischen Blau und Grün, die Figuren einzeln oder in kleinen Gruppen gesetzt.
Enzingers Gedichte in ahabs blau sind deutlich sparsamer als im Vorgängerband, in dem die Langzeilen vorherrschten und der Autor sein breites formales Können vielfach unter Beweis stellte. Dennoch sind einige der typisch Enzingerschen Verfahren auch in den neuen Gedichten zu entdecken, allen voran die Verfremdung von Redewendungen, das Spiel mit Topo- und Homonymen sowie die Verwendung von Eigennamen als Ausgangspunkt für verschiedenste Assoziationen: „schwall oder schwalbe“, harpune / harfe / fahne“, „pechiger kelch / hagebutte / blut“ „licht nein / nichts sein“. Die Gediche in ahabs blau sind in ihrer experimentellen Gestaltung nicht weniger verspielt als jene in mechanismen und defekte, auch hier bleiben Assonanz und Alliteration und ganz selten der Reim die zentralen Gestaltungselemente: „knistert zitternd im wind“, „herd / herde / herbst / herz“, „acht raben/ an der route courbet“. Das Lautliche hat immer wieder Vorrang vor dem Semantischen, der Rhythmus vor der Bekanntheit eines Namens oder Begriffs: „ahabs hermelin / zeppelin / zapin“. Dabei werden Wörter auf ihre (Bedeutungs)möglichkeiten hin untersucht. Manchmal sind es (auch französische) Begriffe, die nur wegen einer lautlichen Ähnlichkeit in den Text eingebaut werden und dabei wiederum neue, ungewöhnliche Bilder evozieren: „eisenbahn / oiseau“, „dünne feuer im tunnel / trauer funkeln die farne / dornen in der krone / frühe feuer“.
Kleine, ästhetisch ansprechende Szenerien entstehen dabei; es sind stille, stimmungsvolle, oft melancholisch-düstere Bilder, die gelegentlich einen dezenten Hinweis auf Orte, Landschaften oder literarische Vorbilder enthalten. Die reduzierten, aber wirkungsvollen poetischen Miniaturen finden ihre Entsprechung in den ruhigen, kühlen, nicht minder rätselhaften Bildern. Die monochromen Figuren, von denen mehr als die Hälfte in kalten Farben gehalten ist, unterstreichen die melancholische oder, seltener, die fröhlich-verspielte Grundstimmung eines Gedichts.
Ahabs blau ist Lektüre für äußerst stille, konzentrierte Augenblicke. Mit ungebrochener Aufmerksamkeit wollen diese poetischen und graphischen Miniaturen immer wieder von Neuem gelesen und betrachtet werden. Es sind rhythmisch wie lautlich raffinierte, assoziativ interessante Ausschnitte des Wahrnehmbaren. Ein kleiner, feiner Glücksfall für jeden echten Lyrikleser, präsentiert in gar nicht so kleinem Format.