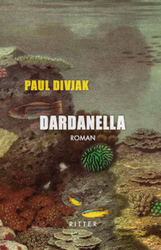Nichts als eine Klippe, wenn der Morgen tagt.
Mit einem namenlosen Erzähler schickt Paul Divjak uns in seinem neuen Roman Dardanella auf eine Fahrt zwischen Gegenwart und Zukunft – oder doch Vergangenheit? Wie er an Bord der Dardanella gekommen ist? Unklar. Auf welchen Hafen das Schiff Kurs nimmt? Unklar. Warum der Erzähler und die anderen Passagiere auf die Dardanella geflohen sind? Weniger unklar:
Ein Gewitter zuckte am Himmel, an dem Tag, als es der Welt zu viel wurde und die Kettenreaktionen in Asien die Herrschaft über das Kühlwasser erlangten, der Himmel im Nahen Osten wiederholt von Raketenleuchten erhellt wurde und die letzten Kähne mit Hoffnungssuchenden vor dem Festland unseres Kontinents kenterten.
Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, war, dass auch unser Schiff schon bald sinken würde.
„Wir“ – das sind neben dem Ich-Erzähler unbekannte, aber auch prominente Mitreisende. Da wäre etwa der Fliegende Holländer, ein alter Seelöwe, der Kapitän, ein Finanzhai, eine Tänzerin, aber auch die österreichische Schauspiellegende Oskar Werner, der, Aphorismen von sich gebend und den schweizerisch-französischen Regisseur Jean-Luc Godard zitierend, allein durch seine Stimme für Euphorie sorgt: „Ich sah mich um. Oskar Werner hatte sich eben wieder in den deutschen Schiffsarzt verwandelt. Sein unverwechselbares Timbre begeistert alle; das Leben schien nun in Schwarz-Weiß viel bunter. – Prädikat wertvoll.“ Auf Stanley Kramers Schwarz-Weiß-Film Ship of Fools (dt. Titel: Das Narrenschiff) aus dem Jahr 1965 wird nicht zum ersten und letzten Mal gedeutet. Dabei zeigt Divjak seinen souveränen Umgang mit intermedialen Verweisen, indem er mit dem „Prädikat wertvoll“ auch gleich auf die Beurteilung durch die Filmbewertungsstelle Wiesbaden hindeutet.
Kramers Ship of Fools und dessen literarische Vorlage, der Roman Ship of Fools (1962), geschrieben von der US-amerikanischen Autorin Katherine Anne Porter, erzählen von der Überfahrt einer buntgemischten Reisegruppe mit dem Dampfschiff Vera von Veracruz (Mexiko) nach Bremerhaven. Wie auch in Divjaks Roman schwanken die Figuren in beiden Werken sowohl zwischen individuellen Boshaftigkeiten als auch kollektiver Vereinnahmung, Ignoranz und Gewalt. Doch während die beiden Vorgänger vor allem den aufkommenden Nationalsozialismus der 1930er Jahre thematisieren, richtet Divjak das Brennglas auf jüngste Ereignisse.
So etwa auf die Regenschirm-Bewegung aus dem Jahre 2014, die sich für freie Wahlen bzw. deren Erhalt in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aussprach:
Pfefferspray und Tränengas konnten ihnen nichts anhaben, sie trugen ihre Regenschirme mit Stolz, zogen friedlich durch die Straßen – alle waren miteinander verbunden. Das Licht hunderttausender Feuerzeuge erhellte die Stadt, die nun vor unseren Augen auftauchte. Es schien, als würde sie aus ihrem wahren Inneren heraus erstrahlen. Warm und weich setzte sich dieses Licht von jenem der künstlich beleuchteten Wolkenkratzer ab, die zu kalten Mahnmalen einer vergangenen Kultur geworden waren.
Dardanella stimmt einen Abgesang in Moll auf die Zivilisation an, zeichnet den Einbruch der Barbarei in das Individuum auf und zeigt die daraus folgende Ziellosigkeit einer amorphen Masse auf. Zwischen den Gedankensplittern des Erzählers taucht immer wieder die aufgedunsene Leiche eines Schweizer Finanzhais auf und wird vom Erzähler und den anderen Figuren – mehr oder weniger empathisch – begutachtet. Allerdings sind die Beobachtungen des Erzählers mit Vorsicht zu genießen, da häufig vor oder nach seinen Zeilen der Griff zum Alkohol oder Kokain erfolgt.
Überhaupt zeigt sich der Erzähler offen in seiner Selbstbeschreibung und bleibt doch unnahbar. Was weiß man über ihn? Etwa, dass er unförmig ist: „Mein Körper erinnerte sich schon lange nicht mehr daran, dass ich eigentlich ein anderer war, dass in ihm ein Fremder gefangen war. Hinter wuchernden Fettzellen verbarg sich ein mir gänzlich Unbekannter.“ Neben Fragen über die Sinnlosigkeit der eigenen Existenz und die kapitalistische Lebensweise beschäftigt ihn auch seine eigene wohlhabende Herkunft, die sich im menschenverachtenden Mantra der verstorbenen Mutter manifestiert und in seinem Kopf nachklingt: „Wenn du’s nicht bringst, dann musst du eben Touristenklasse fliegen.“ An Bord der Dardanella kommt es gar zu einer Erscheinung der Mutter, die, von ihrer Magersucht gezeichnet, vor den Augen des Erzählers auftaucht und über den Sohn urteilt: „Manchmal denke ich, du bist gar kein Mensch. Du bist ein Chamäleon. Du veränderst deine Erscheinungsform, bist mal Tier, Mensch, Ding, mal Gedanke. – Und du bist hässlich und fett.“
Die Figuren in Dardanella sind bösartig, brutal und irre. Nicht von ungefähr setzt Divjak dem Buch ein Zitat aus Erziehung nach Auschwitz (1966) von Theodor W. Adorno als Motto voran: „Je dichter das Netz, desto mehr will man heraus, während gerade seine Dichte verwehrt, dass man heraus kann.“ Die Passagiere der Dardanella sind in diesem zivilisatorischen Netz gefangen, das alles vergesellschaftet und den Einzelnen und das Besondere einschnürt, bis Wut und Gewalt zu Mitteln der vermeintlichen Befreiung werden.
Nach seinen letzten essayistischen Beobachtungen widmet sich Paul Divjak in diesem Buch einer surrealen Sicht auf die Welt. Der Text nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine Schifffahrt der Sonderklasse. Mit an Bord sind neben skurrilen Figuren und intermedialen Verweisen auch Fragen nach Wirklichkeit und Autonomie: Wer bestimmt, was wirklich und unwirklich ist? Und kommt es darauf an? Ja, ist man selbst denn wirklich real oder nur eine Ansammlung von Vielem? Mit einer präzisen Sprache, einprägsamen Bildern und gekonnt eingesetzten Humor geht Dardanella diesen Fragen nach.