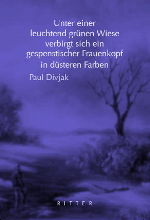Eine flüssige Erzählung, eine Biographie Bienenfelds entsteht so nicht. Man erfährt zwar vieles über ihn, aber auf Details, Zusammenhänge oder einen zeitlich nachvollziehbaren Ablauf wird verzichtet.
Divjak formt mit Worten Bilder, eine Unzahl von Bildern, die eine innerlich zerrissene, unsichere Person erkennen lassen, die an sich selbst zweifelt. Ein Mann, der es zu nichts bringt, der seine Familiengeschichte abarbeiten muss und doch keinen Zugang, keine enge Beziehung zur Familie gefunden hat. Einer, der immer gerne anders wäre als er ist und doch eigentlich alle Möglichkeiten dazu hätte.
Bienenfeld wird überwältigt, überfordert, von all den Erinnerungen, von all den Informationen, die in seinem Leben auf ihn zuströmen. Das sind Eindrücke, Texte, Töne und Bilder aus den unterschiedlichsten Quellen. Aktuelle Kunst steht neben klassischer Musik, Franz Kafka neben Karl May Filmen. Dazu viele persönliche Kindheitseindrücke und ein schier unerschöpfliches Familienarchiv von unaufgearbeiteten Geschichten. Bienenfeld bleibt selten bei einem Thema, einem Eindruck stehen, er ‚zappt‘ sich rastlos durch seine Erinnerungen.
Er ist ein moderner Bildungsbürger. Aber: „Er verliert sich im Labyrinth seines Arbeitszimmers.“ Und er glaubt: „Die Anderen leben draußen, außerhalb des Archivs.“
So ist Bienenfeld einer, der in Assoziationen eintaucht, sprunghaft zwischen Bildern wechselt und darüber zu nichts kommt. Er ist ein Schriftsteller, der nie geschrieben hat, weil er zu viele Informationen hat. Dass sich die meisten Informationen allerdings um ihn selbst drehen, das merkt er zu spät.
Seine Vorstellung ist, dass alle anderen glücklicher, zufriedener seien, handfeste Dinge im Leben regeln könnten, während er durch ein reiches Erbe dazu verdammt sei, kein Ziel verfolgen zu müssen.
Aber das Buch schildert nicht nur das Schicksal eines verwöhnten Sonderlings, es ist ein Spiegel der Generation des Autors. Sie ist mit dem Zappen im Fernsehen und Unmengen von Illustrierten groß geworden. Das Surfen im Internet ist Alltagsroutine. Die Bilder- und Assoziationsfluten sind überwältigend. Alles wird nur angeschnitten, kein Wissen mehr vertieft. Niemand kennt sich mehr aus, aber alle haben eine Ahnung.
Zugleich werden immer noch Idealbilder – zum Beispiel von Familien – transportiert, deren Realität an der Wirklichkeit längst zerschellt ist. Wie die Familie von Bienenfeld, einem Scheidungskind, das den Rest seines Lebens diese Scheidung abarbeiten muss und zugleich selbst bindungsunfähig ist.
Das erstaunliche ist, dass der Autor mit all diesen Assoziationen und Bildern eine unglaublich faszinierende Stimmung schafft, wenngleich eine Trauer das gesamte Buch durchzieht. Es geht um nichts konkretes, es gibt keinen klaren Handlungsstrang, aber die Bilder sind sehr intensiv.
Unter einer leuchtend grünen Wiese verbirgt sich ein gespenstischer Frauenkopf in düsteren Farben ist kein Drogenbuch, kein Horrorschocker, sondern der Spiegel für das Befinden so vieler Menschen der Generation von Paul Divjak.